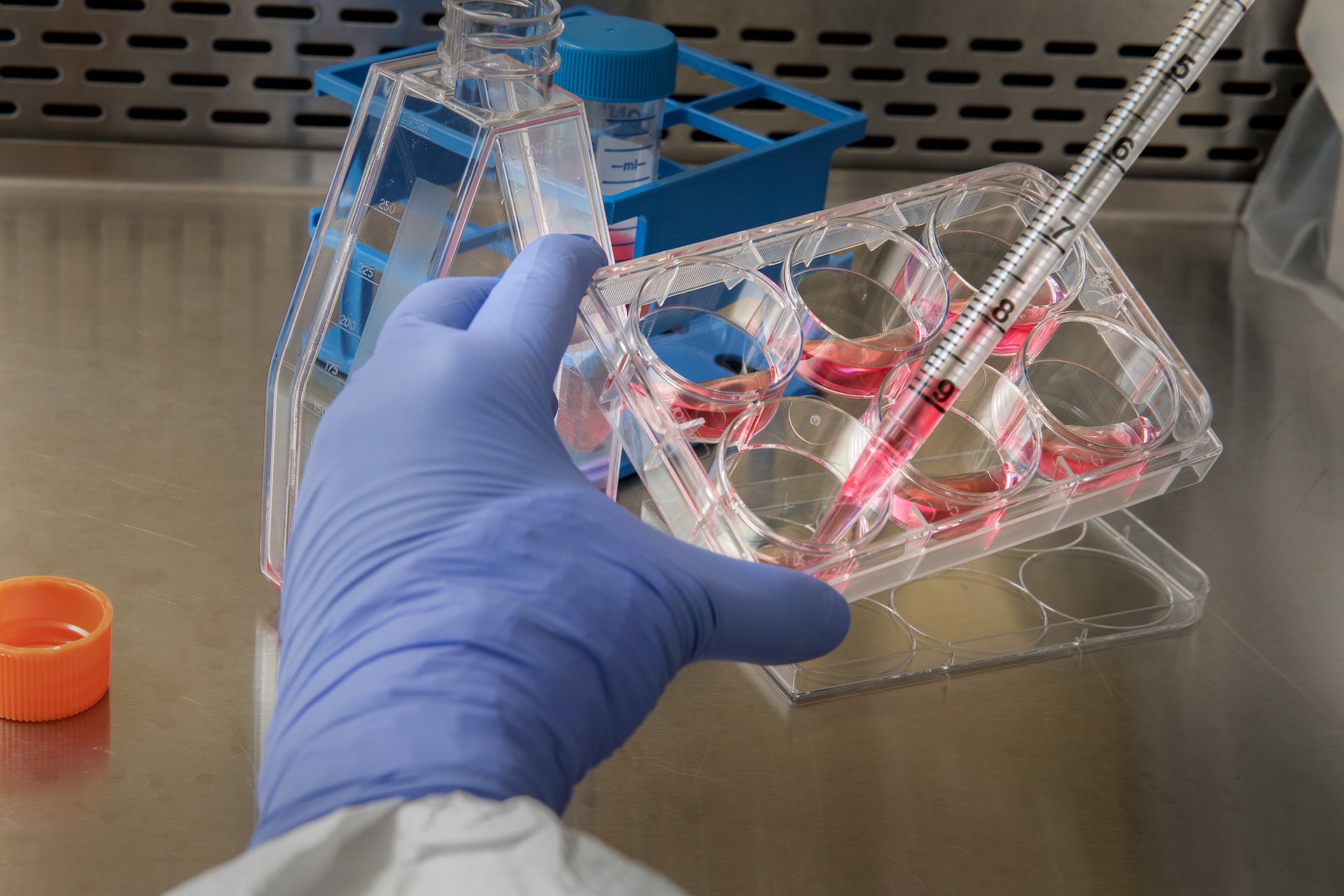Sicherheitsrelevante Forschung in der Virologie
13/03/2025
Sicherheitsrelevante Forschung in der Virologie
Aufruf für einen rationalen Diskurs über Risiken und Chancen von „Gain-of-Function-Forschung“ in der Virologie
Die Gesellschaft für Virologie (GfV) e.V. begrüßt das große öffentliche Interesse an der virologischen Forschung. Die Fachgesellschaft wendet sich mit diesem Positionspapier an Medienvertreter*innen, Wissenschaftler*innen sowie inte-ressierte Personen und fasst die bewährten regulativen Rahmen-bedingungen für Gain-of-Function (GoF) Forschung zusammen. Gleichzeitig wirbt die GfV für einen rationalen und sachlichen Diskurs über die Risiken und Chancen von GoF in der virologischen Forschung.
Medienberichte über die Risiken und die Notwendigkeit von Forschung an Viren und den strukturellen Maßnahmen zur Kontrolle, Über-wachung und Risikoreduzierung dieser Arbeiten haben während der SARS-CoV-2 Pandemie deutlich zugenommen. Dabei wird insbesondere der Begriff „Gain-of-Function“ häufig in wenig differenzierter Form verwendet und der fälschliche Eindruck vermittelt, diese Methode würde vorwiegend gezielt von Forschern angewendet, um die Pathogenität von Krankheitserregern zu erhöhen.
Was bedeutet GoF-Forschung in der Virologie und warum ist sie notwendig?
Viren haben die Fähigkeit, durch Mutationen ihr Erbgut ständig zu verändern. Dies ist Teil ihrer natürlichen Evolution, um sich beispielsweise an neue Wirte anzupassen, den Abwehrmechanismen des Immunsystems zu entgehen oder Resistenzen gegen antivirale Medikamente zu entwickeln. Der Erwerb von GoF-Mutationen, die sich positiv auf die Virusvermehrung auswirken, ist somit eine intrinsische Fähigkeit von Viren. GoF ist aber auch ein integraler Bestandteil der Forschung. Das Hinzufügen von Eigenschaften wie zum Beispiel eine Hitzeresistenz bei Pflanzen oder die Herstellung von Immunzellen (CAR-T-Zellen), die Tumore bekämpfen können, fallen ebenfalls in diese Kategorie. In der virologischen Forschung steht GoF für eine wissenschaftliche Methodik, bei der Veränderungen in das Erbmaterial eines Virus eingeführt werden, um dem Virus eine neue Eigenschaft zu geben oder bestehende Eigenschaften des Virus zu verstärken. Dies kann prinzipiell in zwei unterschiedlichen experimentellen Ansätzen erfolgen: Entweder durch gezielte Veränderungen des Erbmaterials mittels molekularbiologischer Verfahren der Gentechnik. Ein Beispiel ist das Einfügen von Genen für Fluoreszenzproteine in ein Virusgenom mittels Gentechnik, wodurch infizierte Zellen im Laborversuch einfacher zu identifizieren sind. Dabei wird die Pathogenität nicht erhöht. Oder das Kultivieren des Virus in einer veränderten Umgebung, wodurch bestimmte Mutationen selektiert werden (Adaption). Ein Beispiel dafür wäre die Selektion von Resistenzen gegen antivirale Medikamente, oder von Immunfluchtvarianten durch das Vermehren eines Virus in Gegenwart eines neutralisierenden Antikörpers (z.B. nach erfolgter Impfung). Um zu verstehen, wie sich Viren an die menschliche Immunantwort anpassen oder Resistenzen gegen antivirale Therapien entwickeln können und welche Maßnahmen dagegen schützen können, ist diese Art der Forschung wichtig. Viele Medikamente oder Impfstoffe wären heute nicht verfügbar und wir könnten das pandemische Potential von solchen Viren nicht so gut einschätzen, die bereits in der Natur zirkulieren. Die Nutzung von GoF-Methoden an Viren führt aber in der Regel nicht zu einer Erhöhung der Pathogenität. Sollten Veränderungen eingefügt werden, die möglicherweise das Risikopotential eines Erregers aufgrund veränderter Übertragbarkeit, geringerer Sensitivität gegenüber Medikamenten oder gesteigertem Pathogenitätspotential erhöhen können, fällt diese Forschung in den Bereich der zusätzlich regulierten „Sicherheitsrelevanten Forschung“ und wird auch als GoF-Research of Concern (GoFRoC) bezeichnet.
GoF in der virologischen Forschung
Virologische Studien mit GoF-Aspekten werden u.a. auch im Kontext von Fragestellungen der viralen Pathogenität, des Zelltropismus oder der Übertragungsmechanismen von Viren durchgeführt. Dafür können Viren z.B. genetisch so verändert werden, dass sie an einen anderen Rezeptor der Zelle binden und somit bevorzugt andere Zelltypen infizieren können. In der Zoonoseforschung hilft diese Methode herauszufinden, welche Änderung in der Rezeptorbindestelle eines tierpathogenen Virus den Sprung vom Tier auf den Menschen ermöglicht. In vielen Laboren wird so erforscht, wie in der Natur auftretende Mutationen Eigenschaften von Viren beeinflussen, was eine Einschätzung darüber erlaubt, ob diese in der freien Wildbahn zirkulierenden Viren ein Risiko für den Menschen darstellen können. Diese Forschung ist auch entscheidend bei der internationalen Vorbereitung auf zukünftige Pandemien („Pandemic preparedness“). Häufig geht die Verstärkung oder das Hinzufügen von Eigenschaften (Gain) jedoch zu Lasten der viralen Vermehrungsfähigkeit, so dass diese veränderten Viren ein geringeres Gefahrenpotential als die Ursprungsviren haben.
GoF-Forschung kann nicht vollständig durch alternative Methoden ersetzt werden
Ein signifikanter Anteil von Fragestellungen zu Pathogenen kann und wird in alternativen und vereinfachten experimentellen Modellen (Surrogatmodellen) oder durch bioinformatische Simulationsstudien (in silico-Analysen) untersucht, die Experimente mit pathogenen Viren ersetzen. Oft sind z.B. eng verwandte Viren oder Replikationsmodelle verfügbar, die eine niedrigere Pathogenität aufweisen oder keine infektiösen Viruspartikel bilden und deswegen in einem Labor mit niedrigerer Sicherheitsstufe bearbeitet werden können. Aber gerade die ganzheitliche Aufschlüsselung der komplexen Pathogenitätsmechanismen ist mit alternativen Methoden nicht immer möglich. Bestimmte Fragestellungen z.B. zum Beitrag einzelner viraler Aktivitäten zur Übertragbarkeit oder zu bestimmten Krankheitsbildern können nur durch Experimente mit infektiösen Viren beantwortet werden.
GoF-Forschung wird zur Bekämpfung von Krankheiten und der Prävention/Früherkennung von Pandemien eingesetzt
Viren, die GoF-Veränderungen aufweisen, dienen zur Bekämpfung von Krebs und anderen Erkrankungen (Masemann et al. 2017). Ein gentechnisch verändertes Herpesvirus wird z.B. bei der Behandlung von schwarzem Hautkrebs verwendet (Robinson et al. 2022). Der Ebola-Impfstoff auf der Basis eines abgeschwächten Vesikulären Stomatitis-Virus sowie der SARS-CoV-2-Impfstoff auf Basis eines Adenovirus sind Ergebnisse von GoF-Experimenten (Marzi et al. 2015; van Doremalen et al. 2020). Auch bei der Pandemiebekämpfung und der Prävention kann GoF sicher und zielführend eingesetzt werden. Bei neuauftretenden Mutationen im Genom zirkulierender Viren von Mensch und Tier kann die Auswirkung dieser Mutationen auf die Pathogenität des Virus durch GoF-Forschung untersucht werden. Solchen Experimenten liegt zuerst immer eine Risikobewertung des Forschers und der zuständigen Aufsichtsbehörden zugrunde. Aufgrund einer möglichen Pathogenitätserhöhung werden solche experimentellen Arbeiten in Sicherheitslaboren der dem Risiko entsprechenden Stufe durchgeführt. Die Erkenntnisse können dazu beitragen, eine Erhöhung des pandemischen Potentials eines Erregers frühzeitig einzuschätzen, wie z.B. derzeit bei den hochpathogenen Influenzaviren in Vögeln.
Sicherheitsrelevante Forschung an Viren wird engmaschig reguliert
Jede wissenschaftliche Forschungsarbeit oder Diagnostik mit Krankheitserregern (auch gentechnisch veränderten) unterliegt im deutschsprachigen Raum einer obligatorischen Melde- bzw. Genehmigungspflicht. Dies gilt, im Gegensatz zu den USA, auch für die industrielle (privat finanzierte) Forschung. International werden Krankheitserreger anhand ihres Gefährdungspotentials für den Menschen, aber auch für Tiere und die Umwelt, in Risikogruppen eingeteilt. Daraus ergeben sich die Sicherheitsstufen 1 (kein Risiko) bis 4 (hohes Risiko) (international = Biosafety Level 1-4). Ein Labor für sicherheitsrelevante Forschung muss bauliche und sicherheitstechnische Anforderungen erfüllen, die behördlich überwacht werden, und für die Sicherheitsstufen 3 und 4 von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden müssen. In diesen Laboren sind die Sicherheitsstandards so hoch, dass bei sachgemäßem Umgang ein unabsichtliches Entweichen der Erreger sicher verhindert wird. Zusätzlich gelten für diese Labore sehr strikte Zugangsregelungen. Alle experimentellen Arbeiten müssen von fachkundigen Personen überwacht werden und es gibt strenge Regularien zu den notwendigen fachlichen Qualifikationen, die Forschende für Untersuchungen von Krankheitserregern im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes erwerben müssen. Zuverlässigkeit und Arbeitserfahrung sind die entscheidenden Kriterien. Nur entsprechend geschultes Personal, das regelmäßig über die einzuhaltenden Sicherheitsstandards belehrt wird, darf in Sicherheitslaboren tätig sein. Gentechnische, virologische Forschungsprojekte in den Sicherheitslaboratorien der Stufen 3 und 4 müssen bei den jeweils zuständigen Behörden vor Beginn der Arbeiten angezeigt und genehmigt werden. Diese prüfen, ob die Sicherheitsstufe angemessen ist und überwachen regelmäßig, ob die Labore alle Sicherheitsanforderungen erfüllen. Neue Erreger und der rapide technologische Fortschritt gentechnischer Verfahren erfordern jedoch eine Einzelfallbewertung der sicherheitsrelevanten Forschungsvorhaben und führen ggf. auch zu einer Anpassung der Sicherheitsmaßnahmen. Ab der Sicherheits- oder Schutzstufe 3 wird grundsätzlich in Deutschland das bundesweit anerkannte interdisziplinäre Expertengremium, die Zentrale Kommission für die Biologische Sicherheit (ZKBS) und in der Schweiz die Eidgenössische Fachkommission für biologische Sicherheit (EFBS), hinzugezogen. Die ZKBS und EFBS geben auch Empfehlungen und Stellungnahmen zu den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit verschiedenen Erregern ab.
Welche Verantwortung tragen Wissenschaftler*innen und Forschungsinstitutionen?
Die initiale Bewertung geplanter Forschungsvorhaben sowie die Abwägung des Risikos gegenüber dem Erkenntnisgewinns obliegt zunächst der/dem projektleitenden Wissenschaftler*in. Fallen die Experimente in den Bereich der sicherheitsrelevanten GoF-Forschung, dann werden in Deutschland zwei Wege beschritten, um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten: i) beim Einsatz von Gentechnik muss das aktuelle Gentechnikgesetz (GenTG) mit seinen Verordnungen eingehalten werden, für welches der/die Projektleiter*in einer nachweislichen Schulungs- und Dokumentationspflicht unterliegt. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob Alternativverfahren genutzt werden können und welche Maßnahmen zur Risikoreduzierung getroffen werden müssen. Diese Risikoanalyse wird ab der Sicherheitsstufe 3 immer von der ZKBS geprüft. ii) Bei der Beantragung von Forschungsgeldern muss der Antragsteller eine eigene Einschätzung abgeben und diese durch ein Votum einer Kommission für Ethik in der Forschung (KEF) belegen. Beide Stellungnahmen werden dann von Expert*innen des Forschungsgebiets begutachtet. In Deutschland, der Schweiz und Österreich gibt es solche oder vergleichbare Kommissionen zur Bewertung von sicherheitsrelevanter Forschung verschiedener Fachbereiche bereits an 120 Einrichtungen. Zwischen 2020 und 2021 wurden in Deutschland 35 sicherheitsrelevante Fälle quer durch verschiedene Fachdisziplinen in KEFs diskutiert. 17 davon wurden ohne Einschränkungen positiv bewertet, während in 11 Fällen vorsorglich zusätzliche Maßnahmen zur weiteren Risikoreduzierung empfohlen wurden. In mindestens 2 Fällen wurde von einem Forschungsvorhaben abgeraten (Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina und Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), 2022). Die Tätigkeiten der KEFs werden durch regelmäßige Veranstaltungen (KEF-Foren), auf denen sicherheitsrelevante Projekte und deren Beurteilungen vorgestellt und diskutiert werden, unterstützt. Organisiert werden diese Meetings vom Gemeinsamen Ausschuss für sicherheitsrelevante Forschung von DFG und Leopoldina.
Die Sicherheitsregularien für Risikoforschung haben sich bewährt
Nach Auffassung der GfV sind die derzeit bestehenden Sicherheitsstandards und Regulationsmechanismen für die GoF-Forschung an Viren im deutschsprachigen Raum angemessen und im internationalen Vergleich vorbildlich. Eine Verschärfung der Richtlinien zur Regulation und Bewertung von sicherheitsrelevanter Forschung hält die GfV für nicht zielführend, sondern erkennt die Gefahr einer, auch im internationalen Vergleich, unverhältnismäßigen Regulierung und Verlangsamung von notwendiger translationaler und Grundlagenforschung in der Virologie, die den Schutz und den Erhalt der Gesundheit von Mensch und Tier zum Ziel hat. Im Gegensatz dazu empfiehlt die GfV, an der bewährten Evaluierung von sicherheitsrelevanten Forschungsprojekten auf Einzelfallebene durch KEFs, den Fachkollegien der DFG und des Gemeinsamen Ausschusses festzuhalten. Darüber hinaus setzt sich die GfV für einen kontinuierlichen Diskurs über die Sicherheit und Risiken von GoF und GoFRoC, die z.B. durch neue Technologien oder neu auftretenden Viren entstehen ein.
Links:
- Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA): https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/Einstufung.html
- Zentrale Kommission für die Biologische Sicherheit (ZKBS): https://www.zkbs-online.de/ZKBS/DE/Home/home_node.html
- Bayerisches Amt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL Bayern): https://www.lgl.bayern.de/rubrikenuebergreifende_themen/gentechnik/gentechnische_arbeiten.htm#sicherheitsstufen
- Gemeinsamer Ausschuss zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung (AG): https://www.sicherheitsrelevante-forschung.org
- Eidgenössische Fachkommission für biologiesche Sicherheit (EFBS): https://www.efbs.admin.ch/de/startseite
Referenzen:
- Masemann D, Boergeling Y, Ludwig S. (2017) Employing RNA viruses to fight cancer: novel insights into oncolytic virotherapy. Biol Chem. 398(8):891-909. doi: 10.1515/hsz-2017-0103
- Robinson C, Xu MM, Nair SK, Beasley GM, Rhodin KE. (2022) Oncolytic viruses in melanoma. Front Biosci. 27(2):63. doi: 10.31083/j.fbl2702063.
- Marzi A, Robertson SJ, Haddock E, Feldmann F, Hanley PW, Scott DP, Strong JE, Kobinger G, Best SM, Feldmann H. EBOLA VACCINE. VSV-EBOV rapidly protects macaques against infection with the 2014/15 Ebola virus outbreak strain. Science. 2015 Aug 14;349(6249):739-42. doi: 10.1126/science.aab3920.
- van Doremalen N, Lambe T, Spencer A, Belij-Rammerstorfer S, Purushotham JN, Port JR, Avanzato VA, Bushmaker T, Flaxman A, Ulaszewska M, Feldmann F, Allen ER, Sharpe H, Schulz J, Holbrook M, Okumura A, Meade-White K, Pérez-Pérez L, Edwards NJ, Wright D, Bissett C, Gilbride C, Williamson BN, Rosenke R, Long D, Ishwarbhai A, Kailath R, Rose L, Morris S, Powers C, Lovaglio J, Hanley PW, Scott D, Saturday G, de Wit E, Gilbert SC, Munster VJ. ChAdOx1 nCoV-19 vaccine prevents SARS-CoV-2 pneumonia in rhesus macaques. Nature. 2020 Oct;586(7830):578-582. doi: 10.1038/s41586-020-2608-y
- Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina und Deutsche Forschungsgemeinschaft (2022): Gemeinsamer Ausschuss zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung – Vierter Tätigkeitsbericht zum 1. November 2022. Halle (Saale), 86 Seiten.
Klicken Sie hier, um zur PDF-Version der Stellungnahme zu gelangen.