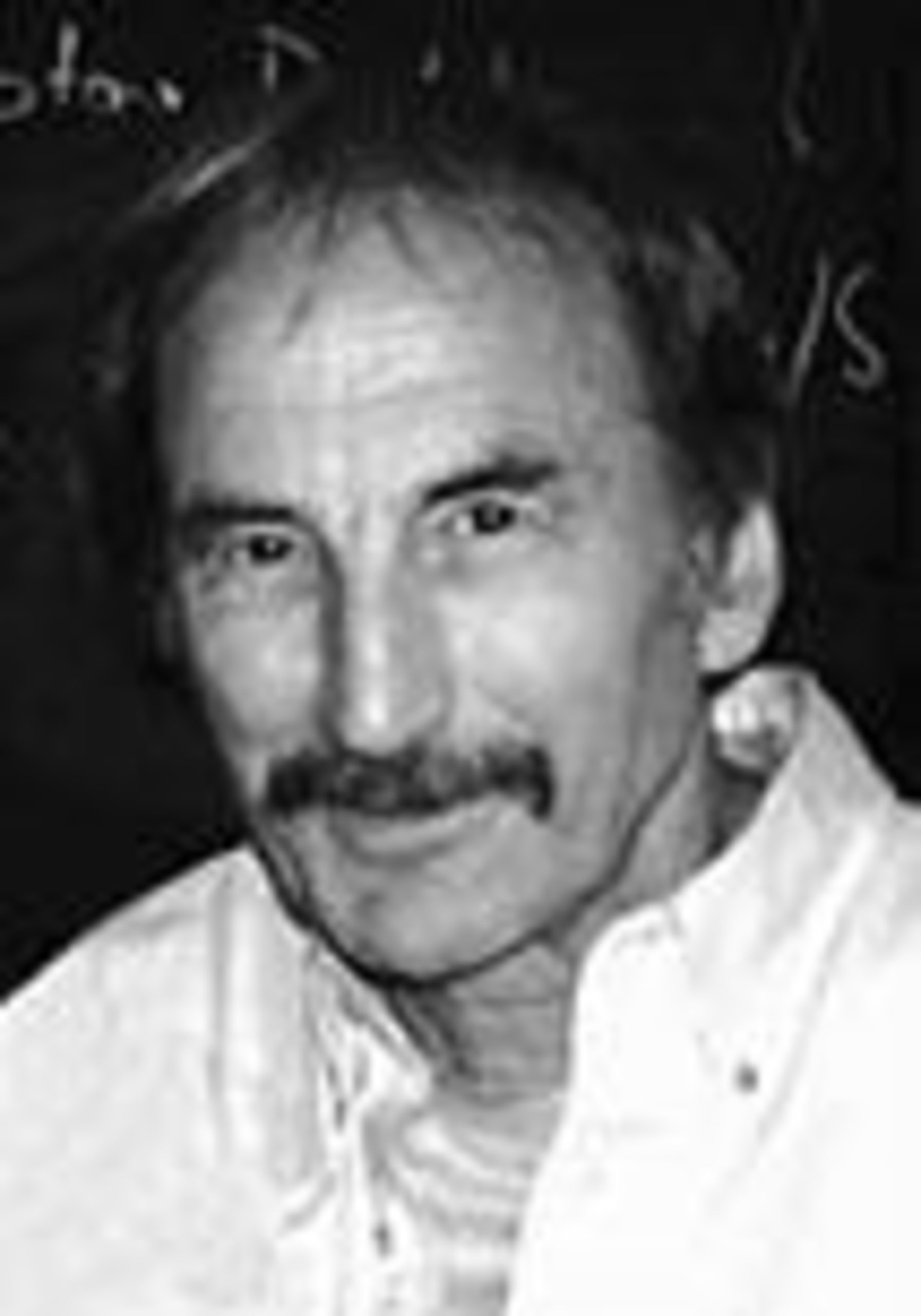In Memoriam
Herr Prof. Dr. Karl-Klaus Conzelmann
23.01.1955
† 23.03.2025
Die Gesellschaft für Virologie nimmt in tiefer Trauer Abschied von ihrem langjährigen Mitglied und Träger des Loeffler-Frosch-Preises 1995, Prof. Dr. Karl-Klaus Conzelmann.
Als geschätzter und langjähriger Professor für Experimentelle Virologie am Max von Pettenkofer-Institut und am Genzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) hat er nicht nur unser akademisches Leben bereichert, sondern auch viele Generationen von Studierenden inspiriert.
Von 1999 bis 2022 leitete Klaus Conzelmann eine wissenschaftlich hochaktive virologische Forschungsgruppe am Max von Pettenkofer-Institut und am Genzentrum der LMU. Sein großer Einsatz für Forschung und Lehre zeichnete sich durch eine außergewöhnliche Expertise, Leidenschaft und ein bemerkenswertes Engagement aus. Mit seiner freundlichen und zugleich anspruchsvollen Art verstand er es, komplexe Themen verständlich zu vermitteln. Seine zahlreichen Publikationen und seine begeisternde Lehre werden noch lange in Erinnerung bleiben.
Klaus Conzelmann leistete in den 1990er Jahren Pionierarbeit in der Etablierung eines neuen Forschungszweigs, der reversen Genetik für negativ-Strang RNA-Viren, darunter Tollwutviren, Masernviren und Influenzaviren. Auf dieser visionären molekularen Technologie basieren alle auch heute noch künstlich hergestellten RNA-Viren mit negativem Strang. Weiterhin trugen Einblicke seiner Arbeitsgruppe maßgeblich zum Verständnis der für die späte Phase der Vermehrung des Tollwutvirus notwendigen viralen Komponenten bei. Seine Ideen und Forschung trugen auch zur Klärung der Frage bei, wie zelluläre Faktoren der angeborenen Immunität wie RIG-I, die RNA eindringender Viren erkennen und vor allem von zellulären RNAs unterscheiden kann. Klaus Conzelmann strebte auch immer nach fächerübergreifenden Anwendungen seiner Forschungsarbeiten: Zum Beispiel entwickelten er und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedene nicht-infektiöse Vektoren für Tollwutviren, bei denen das Hüll-Glykoprotein des Virus entfernt wurde, um die trans-synaptische Verfolgung neuronaler Schaltkreise zu ermöglichen. Durch den Einbau fluoreszierender Proteine erlaubten diese Vektoren erstmals eine Kartierung des „Konnektoms“ von Neuronen im Gehirn. Ein Durchbruch in der Neurobiologie!
Professor Karl-Klaus Conzelmann wird uns nicht nur als herausragender Wissenschaftler, Lehrer und Mentor fehlen, sondern auch als wertvoller Mensch, dessen Freundlichkeit, Weisheit und Humor viele von uns begleitet haben. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, die das Privileg hatten, mit ihm zusammenzuarbeiten.
In dankbarer Erinnerung und stillem Gedenken
Prof. Dr. med. Oliver T. Keppler

Herr Prof. Dr. med. Axel Stelzner
22.07.1937 in Dresden
† 14.06.2024 in Göttern
Die Gesellschaft für Virologie trauert um Herrn Prof. Dr. Axel Stelzner, der am 14.06.2024 im Kreise seiner Familie in Göttern bei Jena verstarb.
Axel Stelzner wurde am 22.07.1937 in Dresden geboren. Er studierte von 1955 bis 1960 das Fach Humanmedizin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 1962 begann er am Institut für Hygiene der Friedrich-Schiller-Universität Jena seine Ausbildung zum Facharzt für Medizinische Mikrobiologie, die er 1967 beendete. In dieser Zeit promovierte er 1963 mit einer immunologischen Untersuchung zur Properdin-Bakterizidie. Von 1968 bis 1980 leitete Axel Stelzner als Fach- und Oberarzt die serologisch-immunologische Abteilung des Institutes für Medizinische Mikrobiologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Mit wissenschaftlichen Arbeiten zur Komplement-Bindungsreaktion wurde er 1971 habilitiert. 1981 wechselte Axel Stelzner zum Zentralinstitut für Mikrobiologie und experimentelle Therapie (ZIMET) der Akademie der Wissenschaften der DDR in Jena. Dort leitete er die Abteilung Immunpathologie, die unter seiner Federführung zur Abteilung Virologie umgebildet wurde. Beginnend mit den politischen Veränderungen 1989 in der DDR übernahm Axel Stelzner gesellschaftliche Verantwortung und trug wesentlich zur überaus erfolgreichen Entwicklung des Wissenschaftsstandortes Jena bei. 1992 wurde das Institut für Virologie am Universitätsklinikum Jena gegründet, welches er bis zu seiner Emeritierung 2002 leitete. Gleichzeitig war Axel Stelzner auch viele Jahre lang Abteilungsleiter für Wirkstoffprüfung am damaligem Hans-Knöll-Institut für Wirkstoff-Forschung und Infektionsbiologie in Jena.
Wissenschaftliche Schwerpunkte im Fachgebiet Virologie waren Untersuchungen zur molekularen Charakterisierung der Pathogenese von Enterovirus-Infektionen unter In vitro- und In vivo-Bedingungen im Verlauf akuter und chronischer Infektionen einschließlich der Entwicklung von Therapiestrategien. Die RT-PCR-basierte Virusdiagnostik klinischer Proben wurde im Kontext enterovirus-bedingter Kardiomyopathien etabliert und routinemäßig eingesetzt. Mit der Gründung des Institutes für Virologie bestand nunmehr auch die Möglichkeit, eine fundierte Ausbildung im Fach Virologie für Studentinnen und Studenten der medizinischen und der biologisch-pharmazeutischen Fakultät anzubieten. Neben den lokalen Aufgaben hat Axel Stelzner viele nationale und internationale Kontakte aufgebaut, die erheblich dazu beigetragen haben, die wissenschaftliche Karriere seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zeiten tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrüche zu fördern. Viele von uns verdanken ihm sehr viel.
Mit der Emeritierung bestand für Axel Stelzner nunmehr die Möglichkeit, sich intensiv für den Erhalt des kulturellen und geistigen Erbes seiner Thüringer Heimat zu engagieren. So hat er sich über viele Jahre hinweg für die überaus gelungene Restaurierung der Dorfkirche in Göttern eingesetzt, in der er als ehrenamtlicher Organist sehr gerne auf der restaurierten Orgel gespielt hat. Als Dank für die Kirchenrettung in Göttern wurde Axel Stelzner zum Ehrenbürger seiner Gemeinde ernannt.
Darüber hinaus engagierte er sich im Rotary-Club Jena. In Vorträgen wies er vehement auf die Gefahren von Infektionskrankheiten hin, wobei ihm besonders die Bekämpfung der Poliomyelitis am Herzen lag.
Wir erinnern uns gerne an Axel Stelzner als engagierten Wissenschaftler, pragmatischen Visionär und begeisterten Historiker. Ohne ihn würde es eine fundierte virologische Forschung in Jena nicht geben. Unsere Gedanken sind bei seinen Kindern und Enkeln.
Andreas Henke, Michaela Schmidtke, Roland Zell, Renate Egerer, Brigitte Glück und Andi Krumbholz
Foto: Universität Jena, undatierte Aufnahme von 1999

Herr Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Bertram Flehmig
23.07.1947
† 27.05.2024
Die Gesellschaft für Virologie trauert um ihr Gründungsmitglied Bertram Flehmig. Er war viele Jahre Virologe an der Universität Tübingen und setzte auch nach seiner Pensionierung als Forschungsdirektor der Mediagnost GmbH in Reutlingen seine wissenschaftliche Arbeit fort.
Bereits als Doktorand konnte er in Reassortment-Versuchen bei Influenzaviren die Kopplung von Virulenzfaktoren und deren Weitergabe an die Tochterviren nachweisen. Bahnbrechend waren seine Untersuchungen zum Hepatitis-A-Virus, das er als einer der Ersten in Zellkultur vermehren konnte. Dies schuf die Voraussetzung für seine Entwicklung des weltweit ersten Hepatitis-A-Impfstoffs, dessen Wirksamkeit er in einer klinischen Studie nachweisen konnte. Auf dem HAV-Antigen basierende Totvakzine wurden in den 1990er Jahren in Europa und den USA zugelassen.
Bertram Flehmig‘s Untersuchungen zur Anzüchtung von Hepatitis-A-Virus in Zellkultur waren die Basis für seine Studien zur zellulären Immunität und zur Kooperation auf diesem Gebiet mit seiner Ehefrau Angelika Vallbracht. Er war ein Pionier in der Entwicklung der Immundiagnostik und Prophylaxe von Hepatitis-A-Infektionen und hat mit seinen grundlegenden Arbeiten zum internationalen Renommee der deutschen Virologie wesentlich beigetragen.
Am 09. Juli 1990 gehörte Bertram Flehmig zu den 67 in Nürnberg versammelten Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die die Gesellschaft für Virologie e.V. gründeten.
Er war ein vielseitig interessierter Mensch, der in seiner Heimatstadt Tübingen als Stadtrat Verantwortung übernahm, aber auch viele Jahre als erster Geiger im Kammermusikkreis Capella Tübingen aktiv war. In geselliger Runde konnte er viele Lebensweisheiten seines Lieblingsdichters Wilhelm Busch frei zitieren…
Wir vermissen den Freund und Wissenschaftler und werden Bertram nie vergessen.
Detlev H. Krüger, Berlin
Thomas Mertens, Ulm
Heinz Zeichhardt, Berlin

Herr Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. habil. Hans Joachim Wolf
09.03.1945 in Kronach
† 03.05.2024 in Starnberg
Die Gesellschaft für Virologie trauert um ihr Gründungsmitglied Herrn Professor Dr. rer. nat. Dr. med. habil. Hans Joachim Wolf. Hans Wolf studierte Biologie und Chemie an der Justus-Maximilians-Universität Würzburg, wo er 1971 im Labor von Harald zur Hausen seine Promotion zum „Nachweis von Viren in bestimmten Krebsarten des Menschen und die mögliche ätiologische Beziehung zur Entstehung dieser Krebsarten“ begann. Nach Erteilung des Doktorgrades (Dr. rer. nat.) an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen verbrachte Hans Wolf zwei Jahre als Gastwissenschaftler bei Bernard Roizman an der University of Chicago. 1977 kehrte Hans Wolf nach Deutschland zurück an das Max von Pettenkofer Institut der Ludwig-Maximilians-Universität in München, wo er an der Medizinischen Fakultät habilitierte und kurz darauf zum C2 Professor für Molekulare und Tumorvirologie ernannt wurde.
1991 erhielt Hans Wolf als Gründungsdirektor den Ruf auf den Lehrstuhl für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Universität Regensburg. Diese Position bekleidete Hans Wolf bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2010. Von 2001 bis 2003 diente er der Medizinischen Fakultät als Dekan. Besonderes Verdienst gebührt Hans Wolf für den Aufbau des Instituts und die Integration der Bereiche Virologie, Mikrobiologie und Hygiene in die Krankenversorgung, die Forschung und Lehre. 1992 wurde das Institut zum WHO Collaborating Centre for Research and Control of Virus-associated Cancers und 1995 zum WHO Collaborating Centre for Viral Hepatitis ernannt.
Mit dem Namen Hans Wolf eng verbunden sind seine Arbeiten zur Epstein-Barr Virus-assoziierten Entstehung des Nasopharynxkarzinoms (NPC). Ausgehend von Untersuchungen zur Pathogenese des NPC in Hochendemiegebieten in China verfolgte Hans Wolf immer auch praktische Aspekte, wie z.B. die Entwicklung moderner Diagnostika und präventiver Impfstoffe, mit großer Ausdauer, bis hin zu fortgeschrittenen klinischen Studien. Dieses Rollenmodell angewandter Grundlagenforschung adaptierte Hans Wolf beginnend Mitte der 80er Jahre auf das Humane Immundefizienzvirus, u.a. mit Fokus auf die Entwicklung und Testung von HIV-Impfstoffkandidaten. Hans Wolf war Gründungsmitglied der 2002 ins Leben gerufenen EUROVACC Stiftung, die sich der Koordination international geförderter Programme zur Entwicklung von Impfstoffen annimmt und bis heute Bestand hat.
Hans Wolf motivierte junge Wissenschaftler und schuf Rahmenbedingungen, die die Entwicklung eines eigenen wissenschaftlichen Profils ermöglichten. Durch das Streben nach Translation von Forschungsergebnissen inspirierte Hans Wolf seine jungen Mitarbeiter zur Ausgründung von Biotech-Firmen, wie z.B. der Mikrogen GmbH, der Lophius GmbH und der Geneart AG, die zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen und berufliche Karrieren gebahnt haben.
Hans Wolf hat zahlreiche nationale und internationale Forschungsverbünde (DFG, BMBF, EU) angestoßen und diese in diversen Funktionen unterstützt. Er diente verschiedenen Wissenschaftlichen Beiräten, u.a. des Heinrich-Pette Instituts, des EC Research Integrated Project TB-VAC und des GEDE AIDS and Infectious Diseases Research Institute (Nigeria) als Vorsitzender und dem Wissenschaftlichen Beirat des Instituts für Tropenmedizin in Heidelberg als stellvertretender Vorsitzender.
Bereits 1983 wurde Hans Wolf für seine Verdienste in der Krebsforschung mit dem Curt-Bohnewand Preis ausgezeichnet. Für die langjährige wissenschaftliche Zusammenarbeit im gemeinsamen Kampf gegen Krebs und AIDS erhielt Hans Wolf Honorarprofessuren des Institute of Virology der Chinese National Academy for Preventive Medicine, Beijing, des Institute of Medical Biology der Chinese Academy of Medical Sciences, Kunming, sowie des National Center for AIDS/STD Disease Control and Prevention, Beijing. 2004 wurde Hans Wolf durch den chinesischen Premierminister Wen Jiabao in Beijing der Friendship Award, die höchste Chinesische Auszeichnung für ausländische Wissenschaftler, verliehen.
Wir erinnern uns gerne und dankbar an Hans Wolf als inspirierenden Wissenschaftler, Motivator und fürsorglichen Institutsdirektor.
Prof. Dr. Wolfgang Jilg, Prof. Dr. Hans Helmut Niller und Prof. Dr. Ralf Wagner

Frau professor dr. rer. nat. Angelika Vallbracht
05.05.1949
† 11.12.2023
Die Gesellschaft für Virologie trauert um Frau Prof. Dr. Angelika Vallbracht, die am 11. Dezember 2023 im 75. Lebensjahr völlig unerwartet verstorben ist.
Der erste Abschnitt ihrer wissenschaftlichen Karriere vollzog sich in Tübingen, wo sie seit 1975 hoch beachtete Arbeiten zu Influenzavirus sowie zur Diagnostik und Therapie von Cytomegalievirus- bei immunsupprimierten Patienten durchführte, sich dann aber gemeinsam mit Ihrem Ehemann Bertram Flehmig auf die Erforschung des Hepatitis-A-Virus konzentrierte. HAV war in der dritten Welt, aber auch in Europa, ein häufiger und wichtiger Krankheitserreger, der erst nach Entwicklung einer spezifischen Diagnostik und eines hochwirksamen Impfstoffes – nicht zuletzt in Tübingen – erfolgreich bekämpft werden konnte. Sie folgte 1990 dem Ruf auf den neu gegründeten Lehrstuhl für Virologie im Fachbereich Biologie/Chemie der Universität Bremen, einen der wenigen virologischen Lehrstühle in Deutschland an einer naturwissenschaftlichen Fakultät. Hier setzte sie die Arbeiten zur Rolle der angeborenen und erworbenen Immunantwort auf die HAV-Infektion fort.
Angelika Vallbracht hat mit großem Engagement das Fachgebiet Virologie in wesentlichen Gremien repräsentiert und sich für die Entwicklung und Ausstrahlung unseres Faches eingesetzt. So war sie langjähriges Mitglied der Zentralen Kommission für Biologische Sicherheit beim Robert Koch-Institut sowie stellvertretende Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirates des RKI. Als Gründungsmitglied der GfV hat sie in unserer Fachgesellschaft die Kommission für Gentechnik geleitet und war über viele Jahre aktives Mitglied und kritische Beraterin von Vorstand und Beirat. Unvergessen ist auch ihr Einsatz bei der Durchführung mehrerer Jahrestagungen der GfV und der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten in Bremen.
Angelika war eine Kollegin und Freundin, deren Enthusiasmus, Begeisterungsfähigkeit und Humor auf ihre Umgebung immer ansteckend wirkten. Sie war eine meinungsstarke, unbestechliche Persönlichkeit mit einem großen Herz, die sich klar zu artikulieren wusste. Sie wird uns sehr fehlen.
Detlev H. Krüger, Berlin
Thomas Mertens, Ulm
Heinz Zeichhardt, Berlin

herr Prof. DR. vet. med. dr. h.c. gerd sutter
31.05.1962
† 31.10.2023
Die Gesellschaft für Virologie trauert um Prof. Dr. vet. med. Dr. h.c. Gerd Sutter, der nach schwerer Krankheit am 31. Oktober 2023 im Alter von 61 Jahren verstarb.
Gerd Sutter wurde 1962 in Kaiserslautern geboren. Er studierte Veterinärmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und begann nach seinem Studium im Jahr 1988 im Rahmen seiner Doktorarbeit am Institut für Medizinische Mikrobiologie Infektions-und Seuchenmedizin der Tiermedizinischen Fakultät in München seine Forschung zum Modifizierten Vaccinia Virus Ankara (MVA). Von 1990-1993 arbeitete er als Postdoc in der Gruppe von Bernard Moss an den National Institutes of Health (NIH) in Bethesda, USA. Nach Deutschland zurückgekehrt setzte er seine Forschungen mit seiner eigenen Gruppe am Institut für Molekulare Virologie des Helmholtz Zentrums München fort. Er habilitierte sich 1999 für das Fach Virologie am Institut für Mikrobiologie der LMU München. Ab 2003 leitete er die Abteilung für Virologie des Paul-Ehrlich-Instituts in Langen, in der er neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit auch mit regulatorischen Aufgaben zur Impfstoffentwicklung und -zulassung befasst war. Im Jahr 2009 wurde er zum Universitätsprofessor und Leiter des Instituts für Virologie an der Tiermedizinischen Fakultät der LMU München berufen. Bis 2022 war er zudem Direktor des Veterinärwissenschaftlichen Departments.
Schon während seiner Doktorarbeit entwickelte Gerd Sutter ein besonderes Interesse für Pockenviren, insbesondere für MVA, und die Möglichkeit MVA als viralen Vektor für die Impfstoffentwicklung einzusetzen. Am NIH etablierte er die Methodik zur Insertion von Fremdgenen in das Genom von MVA. Dies ebnete den Weg zu Herstellung von rekombinanten MVA Impfstoffen gegen eine Vielzahl von Infektionserregern. Dieser Meilenstein in der MVA Forschung wurde 1992 hochrangig veröffentlicht. Kurz danach gelang es ihm, den ersten rekombinanten MVA-Impfstoff gegen Influenzaviren zu entwickeln. Ein weiteres Forschungsinteresse von Gerd Sutter betraf das Verständnis für die Entwicklung einer Immunantwort nach MVA-Impfung, um darauf aufbauend eine verbesserte Schutzwirkung zu erzielen. Hierzu hat er grundlegende Arbeiten am Paul-Ehrlich Institut in Langen und im weiteren Verlauf an der Tiermedizinischen Fakultät in München durchgeführt. Als Tierarzt und Virologe fühlte sich Gerd Sutter zutiefst dem One Health-Gedanken verpflichtet. Influenza-, Paramyxo- und Coronaviren sind nur einige der vielen Zoonoseerreger an denen an seinem Institut geforscht wurde. Darüber hinaus hat Gerd Sutter Impfstoffe gegen HIV, Masern, aviäre Influenza, West-Nil Fieber, MERS und COVID-19 entwickelt und in verschiedenen Tiermodellen charakterisiert. Basierend auf diesen präklinischen Daten und dank seiner exzellenten Vernetzung mit Kolleginnen und Kollegen weltweit – nicht zuletzt aufgrund seiner integrativen, umgänglichen Art und seines freundlichen Wesens – gelang Gerd Sutter der entscheidende Durchbruch bei der Etablierung von MVA als Plattform, auf deren Basis eine Vielzahl von rekombinanten MVA Impfstoffen in klinischen Studien im Menschen getestet werden konnten. Damit erfüllte er sich einen lang gehegten Wunsch und legte den Grundstein für eine MVA-basierte Impfstoffanwendung in der Tier- und Humanmedizin.
In weiteren Pionierarbeiten beschäftigten sich Gerd Sutter und seine Mitarbeiter mit der Immunevasion anderer Orthopockenviren, wie beispielsweise des klassischen Vacciniavirus oder des Ektromelievirus, des Erregers der Mäusepocken. Hier zeigte er, dass virale Immunevasionsproteine wichtige Virulenzfaktoren darstellen, da sie früh nach der Infektion der Aktivierung des Immunsystems entgegenwirken. Eine Vielzahl von Virusmutanten wurde von seinem Team hierfür hergestellt und in vitro und in vivo in verschiedenen Tiermodellen charakterisiert. Diese Ergebnisse ergaben ein besseres Verständnis der Pathogenese der durch Orthopockenviren hervorgerufenen Erkrankungen und dienen als Basis für die Entwicklung neuer Therapie-und Präventionsstrategien herangezogen werden. Gerd Sutter war die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses immer ein besonderes Anliegen. Er hat sich dabei mit großem Engagement gerne in die studentische Lehre und die tierärztliche Weiterbildung eingebracht und zahlreiche Promotionsarbeiten betreut. Er etablierte an seinem Institut ein breit angelegtes Forschungsprogramm auf dem Gebiet der molekularen Virologie, das vor allem auf Viren mit zoonotischem Potential und mit Relevanz für die Tier- und Humanmedizin abzielte. Auf diese Weise gab er vielen jungen Forschenden die Möglichkeit zum Start einer wissenschaftlichen Karriere. So sind viele seiner einstigen Doktoranden heute selbst in leitender Funktion tätig.
In seiner Rolle als Projektleiter im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung in der TTU Emerging Infections unterstützte er besonders die Kombination aus Grundlagenforschung und translationaler Forschung. Darüber hinaus war Gerd Sutter langjähriges Mitglied der Kommission zur Sicherheit bei der Erforschung von Variola Virus in der WHO. Im Jahr 2023 wurde er zudem Leiter der Kommission Pockenviren in der WHO-Initiative zur Priorisierung von Pathogenen mit Epidemie- und Pandemiepotential. In der Gesellschaft für Virologie war er viele Jahre aktiv als Mitglied und Vorsitzender der Kommission für Zoonosen sowie Gründungsmitglied und Vorsitzender der Kommission für virologische Forschung mit Dual-Use Potential. Im Jahr 2021 erhielt Gerd Sutter die Ehrendoktorwürde der Tiermedizinischen Hochschule Hannover für seine herausragende Forschungstätigkeit auf dem Gebiet neu auftretender Zoonoseerreger und Infektionskrankheiten sowie für sein Engagement für den One Health-Gedanken.
Gerd Sutter war ein ausgesprochen geselliger Mensch, ein Familienmensch, der neben seiner großen Leidenschaft, der Virologie, jede freie Minute beim Fischen in den verschiedensten Gewässern auf der ganzen Welt verbrachte. Die Isar in München war sein Heimatfluss und auch sein liebstes Fischgewässer. Hier bleiben sehr lebhaft seine detaillierten und amüsanten Schilderungen in Erinnerung, beispielsweise wie er versucht hat, seine Wurftechnik zu verfeinern und Forellen davon zu überzeugen, dass auf der Wasseroberfläche eine fette Beute auf sie wartet. Um auch bei diesem Hobby etwas zu bewegen, engagierte sich Gerd Sutter aktiv im Natur- und Gewässerschutz. So war er viele Jahre im Präsidium des Landesfischereiverbandes (LFV) Bayern und als Vorsitzender eines Ausschusses für Fischerei und Gewässerschutz aktiv.
Gerd Sutter war stets gut gelaunt und hat uns, und sicher viele andere, durch seine positive Ausstrahlung, Begeisterungsfähigkeit, Großzügigkeit und strategische Weitsicht beeindruckt. Gleichzeitig war er ein bescheidener Mensch, der immer ein offenes Ohr für die Probleme anderer hatte und Unterstützung leistete, wann immer er die Gelegenheit dazu hatte. Wir trauern um ihn und werden ihn nie vergessen. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau, seinen Kindern und Verwandten.
Asisa Volz & Ingo Drexler
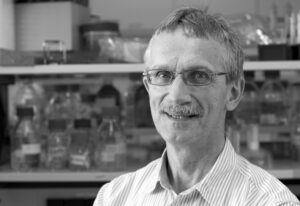
herr Prof. DR. MED. ortwin adams
19.06.1958
† 10.07.2023
Die Gesellschaft für Virologie trauert um Prof. Dr. med. Ortwin Adams, der nach langer Krankheit am 10. Juli 2023 im Alter von 65 Jahren verstarb.
Ortwin Adams wurde 1958 in Oberhausen geboren und studierte Medizin an der Universität Bonn. Nach seinem Studium und anschließender Promotion kam er 1985 als Assistenzarzt an das damalige Institut für Medizinische Mikrobiologie und Virologie der Universität Düsseldorf. In den folgenden Jahren hat er die virologische Diagnostik am Institut betreut und in der Arbeitsgruppe von Herrn Prof. Andreas Scheid seine klinisch-virologische wissenschaftliche Tätigkeit begonnen. Im Jahr 1996 erfolgte die Anerkennung als Facharzt für Mikrobiologie und Virologie und später 2002 die Habilitation für das Fach „Medizinische Mikrobiologie und Virologie“. Nach der Gründung eines eigenständigen Instituts für Virologie durch die Medizinische Fakultät der Universität Düsseldorf im Jahr 2002 war Ortwin Adams ab 2004 dort bis zuletzt als Oberarzt und Leiter der Diagnostik tätig.
Ortwin Adams hat sich mit herausragendem Engagement für die Interessen der Virologie eingesetzt. Am Universitätsklinikum Düsseldorf hat er über viele Jahre die Virologie fachlich in der Klinik vertreten und war als Mitglied des Fakultätsrats maßgeblich an der Gründung eines eigenständigen Instituts an der Universität Düsseldorf beteiligt. Sein wissenschaftlicher Schwerpunkt war die klinische Virologie. Er war immer daran interessiert, Lösungen für neue diagnostische Fragestellungen zu finden und diese in der Krankenversorgung einzusetzen. Insbesondere seine Arbeiten zur molekularen Multiplex-Diagnostik von Atemwegsviren und die Optimierung von Verfahren zum Nachweis von JC-Virusinfektionen im ZNS sind dabei hervorzuheben. Seine Expertise auf dem Gebiet der Diagnostik von JC-Virus als Erreger der progressiven multifokalen Leukenzephalopathie (PML) war international sichtbar und wurde überregional angefragt. Die Sequenzmerkmale von JC-Virusisolaten in der PML und die Viruseigenschaften, die für die Erkrankungsentstehung von Bedeutung sind, waren bis zuletzt Gegenstand seiner Forschungsaktivitäten. Die Ausbildung des virologischen Nachwuchses war ihm ein besonderes Anliegen. Er hat sich mit großem Engagement und viel Freude in die studentische Lehre und die ärztliche Weiterbildung eingebracht und zahlreiche Promotionsarbeiten betreut.
Mit seiner herausragenden klinisch-virologischen Expertise, seiner Motivation und seiner freundlichen und offenen Persönlichkeit war Ortwin Adams eine Bereicherung für die Gesellschaft für Virologie. Er war in verschiedenen Kommissionen wie der Kommission „Antivirale Therapie“ und der Gemeinsamen Diagnostikkommission der DVV und GfV über viele Jahre aktiv und an zahlreichen Leitlinien als Vertreter der GfV beteiligt.
Als Mensch war Ortwin Adams in jeder Situation freundlich, hilfsbereit und immer zugänglich für neue Ideen. Hervorzuheben ist auch sein einzigartiger Humor, den er sich bis zuletzt bewahrt hat.
Wir werden ihn vermissen und sein Andenken in Ehren halten. Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau, den Kindern und seinen Angehörigen.
Jörg Timm

Herr Prof. DR. MED. DR. H. C. MULT. HARALD ZUR HAUSEN
11.03.1936 in Gelsenkirchen
† 28.05.2023 in Heidelberg
Die Gesellschaft für Virologie trauert um ihr Gründungs- und Ehrenmitglied, den Nobelpreisträger Herrn Professor Dr. med. Dr. h. c. mult. Harald zur Hausen. Er war ein Pionier auf dem Gebiet der krebsverursachenden Viren, entdeckte den Zusammenhang zwischen Infektionen mit humanen Papillomviren und Gebärmutterhalskrebs und legte damit die Grundlage für die Impfung gegen diese Erreger. Für seine bahnbrechenden Arbeiten erhielt er 2008 den Nobelpreis für Medizin oder Physiologie.
Harald zur Hausen studierte Medizin in Bonn, Hamburg und zuletzt in Düsseldorf, wo er 1960 promoviert wurde. Nach der Medizinalassistentenzeit in Wimbern, Isny und seinem Geburtsort Gelsenkirchen, erlangte er 1962 die Approbation als Arzt und war anschließend bis 1966 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Düsseldorf.
Bereits zu dieser Zeit fasziniert von der Möglichkeit einer infektiösen Ursache bestimmter Krebserkrankungen begann Harald zur Hausen 1966 einen Forschungsaufenthalt in der Division of Virology am Children’s Hospital of Philadelphia, im Labor von Gertrude und Werner Henle. Zu jener Zeit hatte das Forscherehepaar einen Zusammenhang zwischen dem Epstein-Barr Virus (EBV) und dem Burkitt Lymphom entdeckt, weshalb auch Harald zur Hausen sich während seines Aufenthalts im Henle Labor mit diesem Thema beschäftigte. Dabei lag sein besonderer Fokus in diesen und den folgenden Jahren auf dem molekularbiologischen Nachweis viraler Nukleinsäuren in den Tumorzellen, auch wenn diese keine Viren oder Virusproteine produzierten. Ihn interessierte besonders die Frage, wie Viren menschliche Chromosomen und Gene beeinflussen können, ein Thema, das ihn nicht wieder los ließ. Im Jahr 1968 wurde Harald zur Hausen an der University of Pennsylvania zum Assistant Professor of Virology berufen. Diese Position hielt er bis zu seiner Rückkehr nach Deutschland 1969 inne, wo er sich dem virologischen Institut von Eberhard Wecker an der Julius-Maximilians- Universität Würzburg anschloss. Dort habilitierte er sich im Fach Virologie mit einer Reihe von Originalarbeiten, die sich vorranging mit dem möglichen Zusammenhang von Herpesviren sowie Adenoviren und bestimmten Tumoren des Menschen befassten. Dabei konnte er keine herpesvirale DNA in Gebärmutterhalstumoren nachweisen, obwohl damals die vorherrschende Meinung war, dass diese Viren im Zusammenhang mit der Entstehung dieser Tumorart stehen.
Im Jahr 1972 wurde Harald zur Hausen als Professor auf den neu gegründeten Lehrstuhl des Instituts für klinische Virologie der Universität Erlangen-Nürnberg berufen. Im Rahmen seiner Arbeiten an Genitalwarzen und Gebärmutterhalstumoren reiste er 1976 nach Kenia um dort Biopsien zu sammeln. Er veranlasste, die Biopsien einzeln zu analysieren und fand Hinweise, dass es unterschiedliche Papillomviren gibt. Bestimmte dieser Viren, so seine Vermutung, könnten im Zusammenhang mit Gebärmutterhalskrebs stehen, eine Hypothese, die zu dieser Zeit weitgehend abgelehnt und zum Teil diskreditiert wurde. 1977 wurde Harald zur Hausen auf den Lehrstuhl für Virologie und Hygiene des Zentrums für Hygiene an der Universität Freiburg berufen, wo er mit seiner Arbeitsgruppe in den folgenden Jahren den kausalen Zusammenhang zwischen bestimmten Papillomviren und genitalen Tumoren bestätigte; in dieser Zeit wurden dort die Typen 16 und 18 identifiziert und charakterisiert, die für >70% der Fälle von Gebärmutterhalskrebs verantwortlich sind. Damit war die Grundlage für die Entwicklung entsprechender Impfstoffe gelegt.
Von 1983 bis 2003 war Harald zur Hausen Vorsitzender und wissenschaftliches Mitglied des Stiftungsvorstandes des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg. Dort fand er eine schwierige Lage vor, nachdem eine Begutachtung eine ungenügende wissenschaftliche Aufstellung insbesondere im internationalen Wettbewerb angemahnt hatte. Er besuchte und begutachtete die Gruppen am DKFZ persönlich und verschaffte sich so ein Bild der Lage; in der Folge kam es auf der Grundlage wissenschaftlicher Evaluierungen zu einer deutlichen strukturellen und inhaltlichen Veränderung und Neuorientierung, die das DKFZ in die erste Liga entsprechender Forschungsinstitute brachte. Dies betraf auch die Förderung der frühen Unabhängigkeit junger WissenschaftlerInnen, von denen viele in der Folge führende Positionen in anderen Forschungseinrichtungen übernommen haben. Seine Überzeugung, dass Grundlagenforschung eine wichtige Voraussetzung für medizinischen Fortschritt sei, prägte die zukünftige Ausrichtung des DKFZ in hohem Maße. Diese Überzeugung verband er mit dem zentralen Anliegen, die Ergebnisse der Grundlagenforschung in die klinische Anwendung zu überführen. In Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Heidelberg führte dies zur Einrichtung klinischer Kooperationseinheiten und letztlich zur Gründung des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen in Heidelberg. Dabei behielt Harald zur Hausen sein Interesse an der experimentellen Arbeit und besuchte fast täglich sein Labor, um die allerneuesten Ergebnisse zu besprechen. Im Laufe der Zeit wurde unter der Leitung von Harald zur Hausen der Forschungsschwerpunkt „Angewandte Tumorvirologie“ (heutige Bezeichnung ‚Infektion, Entzündung & Krebs‘) konsequent aufgebaut, um damit das Thema humane Papillomviren und Krebs in allen Facetten untersuchen zu können. Man kann ohne Übertreibung behaupten, dass Harald zur Hausen in seiner 20-jährigen Zeit als Vorsitzender des DKFZ Stiftungsvorstandes diese Institution zu einer international führenden Forschungseinrichtung auf dem Gebiet der Krebsforschung gemacht hat.
Nach seiner Emeritierung im Jahr 2003, erhielt Harald zur Hausen 2008 den Nobelpreis für Medizin “for his discovery of human papilloma viruses causing cervical cancer“, so die offizielle Begründung des Nobelkomitees in Stockholm. Daneben erhielt er eine große Zahl an weiteren hoch-angesehenen Preisen und Auszeichnungen, darunter der Robert Koch-Preis (1975), der Deutsche Krebspreis (1986), der Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preis (1994), der Ernst Jung-Preis und die Jacob-Henle-Medaille (1996), der Prinz-Mahidol-Preis (2005), die Loeffler-Frosch-Medaille der Gesellschaft für Virologie (2007), die Johann-Georg-Zimmermann-Medaille (2007) und der Gairdner Foundation International Award (2008). Außerdem erhielt er für seine zahlreichen Verdienste das Große Bundesverdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, das ihm 2009 vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler überreicht wurde. Des Weiteren war Harald zur Hausen Träger von mehr als 30 Ehrendoktorwürden und Ehrenprofessuren.
Harald zur Hausen gilt zu Recht als ein Pionier auf dem Gebiet krebsverursachender Viren. Er hat dieses Thema mit seinen Arbeiten maßgeblich geprägt und mit großer Energie und entgegen vieler Widerstände seine These über den Zusammenhang zwischen humanen Papillomviren und Gebärmutterhalskrebs verteidigt und letztlich bewiesen. Diese Beharrlichkeit wird häufig als „westfälische Sturheit“ beschrieben und sie war sicherlich ein entscheidender Faktor für den Erfolg seiner Arbeiten. Seine Vermutung ist inzwischen von zahlreichen anderen Arbeitsgruppen belegt. Niemand zweifelt mehr daran und seine Erkenntnisse fanden Eingang in die Lehrbücher. Harald zur Hausen hat mit seinen Arbeiten die Grundlage für die Entwicklung eines Impfstoffs zur Verhinderung der Infektion mit den maßgeblichen onkogenen Papillomviren gelegt. Dank seiner Beharrlichkeit wurden 2006 zwei solche Impfstoffe für die klinische Anwendung zugelassen; deren Wirksamkeit zur Verhinderung von Gebärmutterhalskrebs ist zwischenzeitlich klar belegt. Dies kann ohne Zweifel als ein Meilenstein in der Krebsprävention betrachtet werden. Damit hat Harald zur Hausen nicht nur bahnbrechende Grundlagenforschung geleistet, sondern diese mit Konsequenz in die klinische Anwendung gebracht.
Als Mensch wurde an Harald zur Hausen seine freundlich-zurückhaltende und sachliche Art sehr geschätzt. Für angehende WissenschaftlerInnen hatte er immer einen guten Rat. Einer davon ist uns noch besonders in Erinnerung: „Man soll immer davon ausgehen, dass die meisten Hypothesen, die man aufstellt, falsch sind und entweder korrigiert oder verworfen werden müssen.“ Das erfordert eine gewisse Frustrationstoleranz, die aber zum Dasein als WissenschaftlerIn gehört. Es ist aber auch ein Lernprozess, denn die Annahme, dass wissenschaftliche Aussagen auch in wissenschaftlichen Publikationen unumstößlich sind, ist nicht richtig. Wissenschaft hat eine hohe Dynamik, eine Erkenntnis, die viele von uns und in der Bevölkerung insbesondere während der Pandemie erst lernen mussten. Leider wird uns Harald zur Hausen mit seinen wichtigen Ratschlägen nicht mehr zur Seite stehen. Wir werden ihn schmerzlich vermissen und in bleibender Erinnerung behalten.
Ralf Bartenschlager Hans-Georg Kräusslich
In Würdigung seines Lebens und seiner wissenschaftlichen Leistungen möchten wir Sie auf das Interview der jungen GfV mit Prof. Harald zur Hausen hinweisen, welches im April 2022 im Newsletter der jGfV erschienen ist.
Herr Prof. Dr. Volker Erfle
26.02.1941
† 13.05.2023
1971 begann der promovierter Veterinärmediziner Volker Erfle seine wissenschaftliche Karriere als Leiter eines mikrobiologischen Labors in der Gesellschaft für Strahlenforschung (GSF; heute Helmholtz Munich). 1981 schloss er seine Fachtierarztausbildung und Habilitation in Mikrobiobiologie ab. Seine Faszination galt den Viren, speziell den Retroviren als Auslöser lebensbedrohlicher Krankheiten bei Mensch und Tier. In seinen frühen Arbeiten über die Rolle von Retroviren bei strahleninduzierten Tumoren ging es schon um die Rolle von sogenannten endogenen Retroviren, d.h. Retroviren, die sich im Erbgut festgesetzt haben, bei Tumorerkrankungen in Mäusen und Menschen. Damit war er seiner Zeit weit voraus.
1983 griff er die ersten Berichte über die Isolierung des heute wohl bekanntesten Retrovirus, des HIV-1, aus Menschen mit der erworbenen Immunschwäche AIDS auf und fokussierte seine Arbeit mehr als 30 Jahre auf dieses Virus. Er verfasste zahlreiche Publikationen zu HIV und war einer der ersten Virologen, die erkannten, dass das Virus nicht nur in T-Zellen sondern auch außerhalb des Immunsystems in Virus-Reservoirs dauerhaft verweilen kann.
Volker Erfle zeichnete die Fähigkeit aus, über den Tellerrand hinauszublicken – nach dem Motto „think big“. In der Virologie war er über die Grenzen Deutschlands bekannt für seine innovativen Ideen, für seinen Enthusiasmus und für seine Lebensfreude. Grundlagenwissenschaft und klinische Forschung gingen für Volker Erfle Hand-in-Hand. Um dies in der Praxis umzusetzen, begründete er 1991 das Institut für Molekulare Virologie an der damaligen GSF (heute Helmholtz Munich), und wurde 1997 Direktor des Lehrstuhl für Virologie an der Fakultät für Medizin der TUM. Beide Institutionen sind bis heute sehr aktive Zentren der virologischen Forschung – ein sichtbares Zeichen von Volker Erfle‘s wissenschaftlichem Weitblick.
Volker Erfle blieb menschlich zugänglich und war immer offen für Gespräche und innovative Ideen innerhalb und außerhalb der Forschung. So setzte er sich bereits sehr früh dafür ein, junge Wissenschaftlerinnen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen, z.B. indem er sich vor >30 Jahren für die Schaffung von kinderfreundlichen Arbeitsbedingungen für Mitarbeiterinnen mit Säuglingen einsetzte. Dieser damals liebevoll „Stillzimmer“ genannte Raum war die Basis für die heutige Kindertagesstätte am Helmholtz Munich.
Volker Erfle ist am 13.5.2023 nach langer Krankheit gestorben. Wir werden ihn als Visionär und Lebenskünstler mit einer großen Liebe für die Wissenschaft in Erinnerung behalten.
Ruth Brack-Werner und Ulrike Protzer
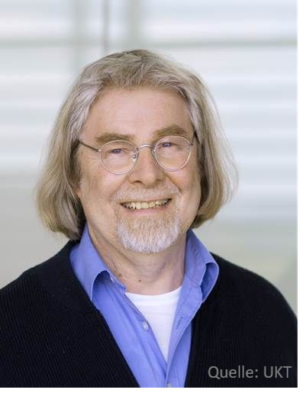
Herr Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Klaus Hamprecht
22.06.1954
† 19.06.2022
Im Juni 2022 verstarb im Alter von 67 Jahren Professor Dr. med Dr. rer. nat. Klaus Hamprecht. Seit mehr als 30 Jahren bis zu seinem Lebensende war er am Institut für Medizinische Virologie und Epidemiologie der Viruskrankheiten am Universitätsklinikum Tübingen tätig und leitete als Oberarzt das Konsiliarlabor für kongenitale und postnatale Cytomegalievirus-Infektionen. Als Mitglied der Gesellschaft für Virologie engagierte er sich insbesondere für die klinische Virologie. Er gestaltete diese bis zuletzt durch unzählige aktive Beiträge mit und war ein weit bekannter und geschätzter Kollege.
Klaus Hamprecht studierte Biochemie und Medizin in München und Tübingen. 1986 schloss er seine naturwissenschaftliche Promotion am Friedrich-Miescher-Labor des Max-Planck-Institutes in Tübingen ab und 1988 seine Medizinische Dissertation. Es folgten Ausbildungsstationen am Universitätsklinikum Ulm, Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart und ab 1991 als Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Medizinische Virologie der Universität Tübingen. Hier baute er die CMV-Diagnostik mittels molekularbiologischer Technologien und sorgfältig etablierter Zellkulturmethoden auf. 1995 erfolgte die Facharzt-Anerkennung, 2004 die Habilitation im Fachgebiet „Klinische Virologie“ und 2007 die Ernennung zum außerplanmäßigen Professor.
Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen und klinischen Arbeit waren die Diagnostik von CMV-Infektionen in der Schwangerschaft, die konnatale und postnatale CMV-Transmission, sowie deren Prävention und Behandlung. Für die Abklärung von Virostatika-Resistenzen entwickelte er genotypische und phänotypische Untersuchungsmethoden, für die Prävention der Virustransmission durch Muttermilch ein patentiertes Virusinaktivierungsverfahren.
Er pflegte eine enge und äußerst fruchtbare Kooperation mit vielen klinischen Partnern, z. B. aus der Pränatalmedizin und der Neonatologie. Seine wissenschaftlichen Artikel, Buchbeiträge und Forschungsergebnisse werden national wie international wahrgenommen.
Unter anderem als Mitglied der Kommission “Virusinfektion in der Schwangerschaft” der DVV und GfV brachte er seine breite Expertise und äußerst detaillierte Literaturkenntnis bei der Erstellung verschiedener Leitlinien ein und trug maßgeblich zu einer verbesserten Patientenversorgung und breiten Sichtbarkeit der klinischen Virologie bei. Die Laborleitertreffen und den Arbeitskreis für klinisch-virologische Forschung der GfV hat er mit seiner Teilnahme stets bereichert.
Klaus Hamprecht war ein hervorragender Dozent und begeisterter Mentor für mehrere Generationen Studierender, Doktorandinnen und Doktoranden verschiedener Fachrichtungen sowie Kollegen und Kolleginnen in der Weiterbildung. Die individuelle Betreuung und Beratung von Patientinnen im Rahmen seiner Tätigkeit für das Konsiliarlabor waren ihm als Arzt immer ein sehr wichtiges Anliegen. Durch sein tiefgehendes Fachwissen war er ein sehr geschätzter Ansprechpartner, auch weit über die Grenzen des Universitätsklinikums Tübingen hinaus.
Sein genuines Interesse am Gegenüber, seine Lebensfreude und Humor prägten sein gesamtes persönliches Auftreten.
Wir bedauern es zutiefst, mit Klaus Hamprecht einen hochgeschätzten Kollegen, großartigen klinischen Virologen und stets hilfsbereiten Freund verloren zu haben.
Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie und Angehörigen.
Tina Ganzenmüller, Stefan Jürgens und Thomas Iftner für das Kollegium des Instituts für Medizinische Virologie, Universitätsklinikum Tübingen und die Gesellschaft für Virologie

Herrn Prof. Dr. med. Hans-Dieter Klenk
25 Juni 1938 in Köln
† 1. Juni 2021 in Giessen
Die Gesellschaft für Virologie trauert um ihr Gründungsmitglied und ihren Altpräsidenten Herrn Professor Dr. med. Hans-Dieter Klenk Hans-Dieter Klenk studierte in Tübingen, Wien und Köln Medizin und Biochemie. Von 1967 bis 1970 war er als Gastwissenschaftler im Labor von Purnell Choppin an der Rockefeller University in New York tätig. Zurück in Deutschland, wurde er 1973 zum C3-Professor an die Justus-Liebig-Universität Gießen berufen und 1985 folgte er einem Ruf auf den Lehrstuhl für Virologie an die Philipps-Universität Marburg und übernahm die Leitung des Instituts für Virologie. Diese Position bekleidete er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2007.
Hans-Dieter Klenk hat die Marburger Virologie sowie die Virologie in Deutschland ganz entscheidend geprägt und ihre internationale Ausrichtung und Sichtbarkeit begründet. Unter seiner Leitung hatten zahlreiche junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Möglichkeit, ihr eigenes wissenschaftliches Profil zu entwickeln und national und international in leitende Positionen berufen zu werden.
Mit dem Namen Hans-Dieter Klenk eng verbunden ist seine sehr erfolgreiche Erforschung von Influenzaviren, insbesondere der Rolle der Oberflächenproteine, des Hämagglutinins und der Neuraminidase in der Pathogenese der Grippe. Weiterhin waren für ihn auch andere zoonotische Viren, die als Emerging Viruses die öffentliche Gesundheit bedrohen, von großem Interesse. Hier konnte er eine neue Forschungsrichtung der Marburger Virologie etablieren, die bis heute sehr aktiv verfolgt wird.
Er leitete zahlreiche koordinierte Programme der Deutschen Forschungsgemeinschaft u.a. den SFB 286 und war als Vorstand für viele wissenschaftliche Beiräte von Forschungsinstitutionen aktiv (Georg-Speyer-Haus, Frankfurt am Main, Feldberg Foundation for Anglo-German Scientific Exchange, Institute of Medical Microbiology, Fudan University). Er war Gründungsmitglied der Gesellschaft für Virologie und leitete als Präsident die Gesellschaft von 1999 bis 2005. Für seine besonderen Verdienste um die Virologie im deutschsprachigen Raum erhielt er 2015 die Loeffler-Frosch-Medaille der Gesellschaft für Virologie. Der von Behring-Röntgen-Stiftung, Gießen-Marburg, stand er als Vizepräsident seit ihrer Gründung zur Verfügung.
Hans-Dieter Klenk erhielt zahlreiche hochangesehene wissenschaftliche Preise, wie die Robert-Koch-Medaille, die Ernst-Jung-Medaille für Medizin und den Emil-von-Behring-Preis. Außerdem wurde ihm im Jahr 2018 das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen.
Hans-Dieter Klenks Persönlichkeit war durch seine natürliche Autorität geprägt, die mit Scharfsinnigkeit und Präzision gekoppelt war. Mit ihm verliert die Virologie in Deutschland eine ihrer großen Persönlichkeiten, die über Jahrzehnte die wissenschaftliche Landschaft geprägt hat und der bis zuletzt ein geschätzter Ratgeber war.
Wir vermissen den exzellenten Wissenschaftler und den geradlinigen, konsequenten und großzügigen Menschen und werden ihn in bleibender Erinnerung behalten.
Stephan Becker

Herrn Prof. Dr. med. habil. leopold Döhner
25. November 1932
† 20. Mai 2021
In seinem neunundachtzigsten Lebensjahr verstarb Leopold Döhner, Gründungsmitglied und erster Vizepräsident der Gesellschaft für Virologie. Im Mittelpunkt seiner Forschungsarbeiten standen die respiratorischen Virusinfektionen, insbesondere durch Influenza- und Adenoviren. Schon 1975 wurde er, von der Medizinischen Akademie Magdeburg kommend, zum Professor für Medizinische Mikrobiologie an die Universität Greifswald berufen. Dort leitete er das gleichnamige Institut – dessen Gründung auf Friedrich Loeffler zurückgeht – bis 1992.
Im Jahre 1993 gründete er in Greifswald das Private Institut für Mikrobiologische Forschung – MICROMUN GmbH, dem er bis zu seinem Tode beratend und freundschaftlich verbunden blieb. Leopold Döhner war ein äußerst angenehmer Kollege, der wissenschaftliche Zielstrebigkeit mit großer persönlicher Bescheidenheit verband. Trotz vielfältiger Verpflichtungen als Hochschullehrer, als Vorsitzender der Gesellschaft für Mikrobiologie und Epidemiologie der DDR und in vielen anderen Aufgaben, ließ er es sich nicht nehmen, auch weiter persönlich experimentell zu arbeiten – also seine Wurzeln im Labor zu bewahren. Für Generationen von Studenten konnte er so die Begeisterung für die virologische Forschung wecken.
Die Gesellschaft für Virologie wird ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.
Detlev H. Krüger, Berlin
Foto: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

Frau Prof. Dr. med. Gisela Enders
25. Mai 1924 in Stuttgart
1. Mai 2021 in Stuttgart
Ein Leben für die medizinische Virologie (1924 – 2021). Am 1. Mai 2021 ist Frau Prof. Dr. med. Gisela Enders, eine Pionierin der medizinischen Virologie, in ihrer Heimat Stuttgart verstorben. Wir sind von Trauer und Hochachtung erfüllt und blicken auf ihr Lebenswerk, das zugleich einen Einblick in die Entwicklung der Virologie in Deutschland als selbständiges Fach in Wissenschaft, Hochschullehre und Medizin gibt.
Frau Enders wurde am 25. Mai 1924 in Stuttgart als Gisela Ruckle geboren und wuchs als echte Schwäbin auf: Sie war fleißig, erfindungsreich, gewitzt, hartnäckig, fürsorglich und durchsetzungsfähig. Medizin zu studieren war ihr großer Wunsch. Selbstständig wechselte sie im Alter von 15 Jahren auf ein Gymnasium und studierte nach dem Abitur von 1943 – 1949 Medizin in München und Tübingen (Promotion 1953). Unter Kriegsbedingungen leistete sie Krankenpflegedienst in einem Lazarett. Nach verschiedenen Zwischenstationen als Gastassistentin an der Universitätskinderklinik in Cambridge und als wissenschaftliche Assistentin in Heidelberg am Institut für Virusforschung nahm sie die Chance wahr, von 1953 – 1956 in den USA die neuesten Entwicklungen der Medizin und Infektiologie kennenzulernen. Die Seuchenbekämpfung war damals eine schicksalhafte, weltweit präsente Herausforderung, insbesondere was die ätiologisch noch weitgehend unerforschten Viruskrankheiten anging. Es gab noch keine funktionierenden Impfungen gegen Influenza, Poliomyelitis, Masern u. a. . Die scheinbar harmlose Kinderkrankheit Röteln war erst 1941 als Verursacher von Embryo- und Fetopathien erkannt worden. Es fehlten Laboranalysen und Erregerisolierung. In Amerika gelang es der jungen deutschen Ärztin u. a. mit einem Fulbright-Fellowship, Mitarbeiterin in Laboratorien amerikanischer Virologie-Pioniere zu werden, zunächst bei Dr. J. Salk (Pittsburgh), der den ersten Polio-Impfstoff entwickelte, und dann bei Dr. J.F. Enders (Harvard, Boston), der gemeinsam mit anderen Forschern die Zellkulturtechnologie etablierte, um pathogene Viren zu isolieren und in beliebiger Menge anzüchten zu können. Das war der entscheidende Durchbruch zur Produktion von Impfstoffen, zur Herstellung von Antigenen für die routinemäßig durchführbare Serodiagnostik und Immunitätsbestimmung, zur Analyse der Virusreplikation und Entwicklung einer spezifischen Therapie.
Bereits im Labor von Salk isolierte Gisela Enders das Masernaffenvirus aus Affennierenzellen. In der Gruppe von J.F. Enders entdeckte sie dann die enge Verwandtschaft zwischen dem Masernaffenvirus und dem menschlichen Masernvirus. Zu dem Nobelpreisträger J.F. Enders bestand keine verwandtschaftliche Beziehung. Aber: „Nomen est omen“, denn Frau Ruckle erhielt den Namen Enders 1957 durch Heirat mit Dr. Gerhard Enders in Deutschland.
Für Frau Enders war der Weg als Frau und Deutsche in den USA doppelt schwierig. Mit großem Engagement und unermüdlichem Fleiß hat sie viel zu den Entwicklungsarbeiten in der aufblühenden Virologie beigetragen und zusätzlich mit ihrer gewinnenden Art geholfen, Vorurteile abzubauen.
Im Jahr 1956 kehrte Frau Enders nach Europa zurück. Zunächst war sie im Institut Mérieux in Lyon am Aufbau der Produktion von Impfstoffen gegen Röteln und Masern beteiligt. Gemeinsam mit anderen US-Rückkehrern hat sie zu dem Technologietransfer beigetragen, der den Aufstieg der Virologie in Deutschland auf ein Spitzenniveau ermöglicht hat. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Hygiene-Institut der Universität Marburg baute sie eine leistungsfähige Virusdiagnostik auf. Schnell erwarb sie sich hohes Ansehen bei der Ärzteschaft in und außerhalb des Universitätsklinikums als kompetente Ansprechpartnerin und Ratgeberin. Ihr lebhaftes Naturell, ihre klaren Stellungnahmen und ihre Verantwortungsbereitschaft im klinischen Problemfall oder in der Epidemiebekämpfung sowie ihr umfangreiches Wissen fanden schnell große und lebenslang bleibende Anerkennung und machten sie früh zu einer begehrten Autorin von medizinischen Buch- und Zeitschriftenbeiträgen.
Im Jahr 1963 zog Frau Enders mit ihrem Mann, dem Orthopäden Dr. Gerhard Enders nach Stuttgart, in die Stadt, die für Gisela und Gerhard Enders und deren beiden Söhne Christoph und Martin zum Lebensmittelpunkt wurde. Dort trat sie in das Stuttgarter Medizinische Landesuntersuchungsamt ein, richtete eine moderne Abteilung für Virusdiagnostik ein und stieg zur Regierungsmedizinaldirektorin auf. Im Jahr 1973 wurde sie habilitiert und erhielt 1976 zuerst in Marburg und dann 1984 in Stuttgart eine Honorarprofessur.
Wissenschaftlich wandte sie sich verstärkt der Problematik von Infektionen mit Röteln und anderen Viren zu, welche die Schwangerschaft und Leibesfrucht gefährden. Im Staatsdienst fühlte sie sich in ihrer Forschungstätigkeit zunehmend eingeschränkt. Kurz entschlossen gab sie daher die gesicherte Beamtenlaufbahn auf und gründete 1979 als Fachärztin für Medizinische Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie mit hohem unternehmerischen Risiko eine eigene Laborpraxis mit virologischem Schwerpunkt. Das Unternehmen hatte durchschlagenden Erfolg. Es ist schnell gewachsen und heute ein großes Institut, das alle Zweige der Labormedizin mit den modernsten Methoden abdeckt und von einer Gemeinschaft mehrerer Laborärzte und Laborärztinnen als Medizinisches Versorgungszentrum betrieben wird. Frau Enders hat ihr Institut mit unermüdlicher Energie stets innovativ geführt und allen diagnostischen Neuentwicklungen angepasst. Herausragend war der ungewöhnlich enge und vertrauensvolle Kontakt zur Ärzteschaft. Das ermöglichte ihr die Durchführung von ungewöhnlich großen und konsistenten wissenschaftlichen Studien auf ihrem Hauptarbeitsgebiet, der Perinatalmedizin. Ihre Erkenntnisse hat sie in vielen internationalen Journalen der Virologie und deutschen Zeitschriften der medizinischen Fortbildung und Buchbeiträgen veröffentlicht. Ihr Buch „Infektionen und Impfungen in der Schwangerschaft“ (1991) wurde zur infektiologischen „Bibel“ der Gynäkologie und Perinatalmedizin. Darüber hinaus verfasste sie zahlreiche Originalarbeiten zum gesamten Spektrum endemischer und neu auftretender Viruskrankheiten und engagierte sich weiterhin für die klinische Virologie in nationalen und internationalen Fachgesellschaften. Hier ist u. a. die Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten e. V. (DVV) zu nennen, die bald nach der Rückkehr von Frau Enders aus den USA von den deutschen Bundesländern zur wissenschaftlichen Beratung (zunächst in der Poliomyelitis-Problematik) gegründet worden war. Die DVV hat der klinischen Virologie, der Kinderheilkunde und dem öffentlichen Gesundheitsdienst erstmals ein Forum geboten, in dem sich die virologischen Experten in Deutschland beraten und in der Praxis austauschen konnten. Selten haben so viele Lehrstuhlinhaber und Abteilungsleiter gemeinsam pipettiert, oft unter Mitwirkung von Gisela Enders. Sie konnte dafür aus einer sprudelnden Quelle schöpfen, der „European Group for Rapid Viral Diagnosis“, die sie mitbegründet hat und deren Ehrenmitglied sie wurde. Durch Zusammenlegung mit der „European Association against Poliomyelitis and Other Viral Diseases“ entstand daraus später die „European Society for Clinical Virology“ (ESCV). Frau Enders hat bis ins hohe Alter ihr hochanerkanntes Laborinstitut geführt, in dem ihr Sohn Priv.-Doz. Dr. Martin Enders vor wenigen Jahren an ihre Stelle getreten ist und ihr Lebenswerk weiterführt.
Gisela Enders hat sich gegen alle Widerstände durchgesetzt und wurde als Wissenschaftlerin, klinisch tätige Ärztin und Unternehmerin stets anerkannt und bewundert. Ihr Schaffen wurde vielfach ausgezeichnet mit nationalen und internationalen Preisen, Orden und Ehrenmitgliedschaften, u. a. mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande für die Leistungen auf dem Gebiet der Virusforschung, der Haackert-Goldmedaille für Verdienste auf dem Gebiet der Pränataldiagnostik, der Albert-Schweitzer-Medaille und dem Maternité-Preis der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin. Im Jahr 2011 wurde sie mit der Loeffler-Frosch-Medaille der Gesellschaft für Virologie für ihr Lebenswerk geehrt.
Mit Gisela Enders verlieren wir die Grande Dame der klinischen Virologie. Sie hat dieses Fach als Pionierin maßgeblich geprägt, indem sie patientenorientierte Diagnostik und wissenschaftliche Tätigkeit verband. Stets unterstützte und förderte sie mit ihrer selbstlosen und wohlwollenden Art ihr Institutsteam sowie ihre Kolleginnen und Kollegen in Nah und Fern und war dadurch nicht nur als Wissenschaftlerin hochgeachtet, sondern auch als Ratgeberin und Freundin generationsübergreifend äußerst geschätzt und beliebt.
Wir werden sie vermissen und in bleibender Erinnerung behalten.
Hans W. Doerr
Heinz Zeichhardt
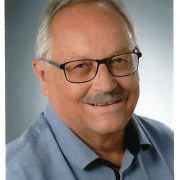
Herr Professor Dr. med. Bernhard Fleckenstein
10. August 1944 in Würzburg
04. Mai 2021 in Schlaifhausen, Wiesenthau
Die Gesellschaft für Virologie trauert um ihren Gründungspräsidenten Herrn Professor Dr. med. Bernhard Fleckenstein. on 1978 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2015 war Bernhard Fleckenstein Inhaber des Lehrstuhls für Virologie an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg und Direktor des Virologischen Institutes am Universitätsklinikum Erlangen. Nach dem Medizinstudium in Freiburg/Br und Wien von 1963 bis 1969, der Medizinalassistentenzeit in Lübeck und der Promotion zum Dr. med. begann er seine virologischen Forschungsarbeiten 1970 am Institut für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Göttingen (Leitung: Prof. Reiner Thomssen).
1972 schloss er sich der Gruppe von Prof. Harald zur Hausen am Institut für Klinische Virologie der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg an, wo er sich 1975 habilitierte. 1976 wurde er zum Associate Professor of Microbiology and Molecular Genetics an der Harvard Medical School in Boston berufen und übernahm die Leitung der Abteilung Mikrobiologie am Primatenzentrum von Harvard University. 1978 wurde er zum Ordentlichen Professor und Leiter des Instituts für Klinische und Molekulare Virologie der Universität Erlangen berufen, wo er nach abgelehnten Rufen auf die Lehrstühle für Virologie an der Universität Freiburg (1987) und der Ludwig-Maximilians-Universität München (1987) bis 2015 lehrte. Auch den Ruf auf die Position des Wissenschaftlichen Mitglieds und Vorsitzenden im Stiftungsvorstand des Deutschen Krebsforschungszentrums lehnte er 2003 ab. Sein Wirken in Erlangen war auch geprägt von einer kontinuierlichen baulichen Fortentwicklung der Virologischen Diagnostik- und Forschungslabore hin zu einem national und international renommierten Zentrum für klinische und molekulare Virologie.
Schon im ersten Jahr seiner virologischen Tätigkeit in Göttingen wandte Bernhard Fleckenstein sich der neuentdeckten Gruppe der Rhadinoviren zu, einer Subgruppe der Herpesviren mit onkogenen Eigenschaften. Diese Arbeiten führte er auch nach seinem Wechsel an die Harvard Medical School in Boston weiter. Er untersuchte die molekularen Mechanismen der durch diese Viren verursachten Lymphome und lymphatischen Leukämien und konnte bereits 1978 in Nature publizieren, dass isolierte virale DNA in Tierexperimenten tumorigen wirkt. Ein weiterer wichtiger Durchbruch auf diesem Gebiet gelang ihm und seiner Arbeitsgruppe in Erlangen, als sie 1992 publizierten, dass einzelne Vertreter dieser Virusgruppe menschliche T-Zellen in Kulturen immortalisieren, d.h. zu kontinuierlichem Wachstum anregen können. Dies ebnete methodisch den Weg zu einer besseren Analyse zentraler Signalwege in Lymphozyten und führte zu einer Vielzahl von kollaborativen Projekten, in denen grundlegende Mechanismen der T-Zellaktivierung aufgeklärt wurden. In weiteren Pionierarbeiten beschäftigten sich Bernhard Fleckenstein und seine Mitarbeiter mit dem menschlichen Cytomegalovirus, einem wichtigen Erreger pränataler Infektionen und von Infektionen bei Immunsupprimierten. Sie klonierten erstmals das gesamte Genom des Virus und führten die molekulare Kartierung der wichtigsten Struktur- und Regulationsproteine durch. In Zusammenarbeit mit Prof. Walter Schaffner, Universität Zürich, entdeckte Bernhard Fleckenstein den Enhancer des Cytomegalovirus, der heute weltweit für die Expression eukaryonter Gene in Zellkultur, in transgenen Tieren und für Versuche der somatischen Gentherapie angewendet wird. An seinem Institut etablierte Bernhard Fleckenstein ein breites Forschungsprogramm zur molekularen Biologie von Herpesviren, Papillomviren und Retroviren, das von einer Vielzahl von jungen Nachwuchswissenschaftlern mitgetragen wurde. Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses war für Bernhard Fleckenstein immer ein besonderes Anliegen, das er auch in seiner Funktion als Sprecher des Sonderforschungsbereich 466 „Lymphoproliferation und virale Immundefizienz“ (von 1996 bis 2008) sowie des Graduiertenkollegs 1071 „Viren des Immunsystems“ (von 2005 bis 2013) nie aus den Augen verlor.
Von 1997 bis 2001 und von 2005 bis 2008 war Bernhard Fleckenstein Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg. In dieser Funktion stellte er wesentliche Weichen für eine leistungsorientierte Universitätsmedizin in Erlangen. Er war Gründungspräsident der Deutschen Gesellschaft für Virologie und Gründungsmitglied sowie erster Generalsekretär der European Society for Virology. Bernhard Fleckenstein gehörte zahlreichen nationalen und internationalen Wissenschaftsgremien an, darunter der Akademie der Wissenschaften und der Literatur zu Mainz und der Deutschen Nationalakademie Leopoldina. Zu seinen Auszeichnungen zählen der Max-Planck-Preis (1991), der Aronson-Preis des Landes Berlin (1991), der Ludwig-Aschoff-Preis der Universität Freiburg (2004) sowie das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (2003) und der Bayerische Verdienstorden (2006).
Auch als Persönlichkeit hat Bernhard Fleckenstein durch seine immer positive Ausstrahlung, Begeisterungsfähigkeit, Großzügigkeit und strategische Weitsicht beeindruckt. Bedingt durch seine tatkräftige und uneigennützige Förderung des akademischen Nachwuchses wurden viele seiner Schüler sowohl national als auch international auf Virologische Lehrstühle und Professuren berufen. Er hat die Gesellschaft für Virologie mitbegründet und wie kaum ein anderer geprägt. Mit ihm verlieren wir einen großartigen und unermüdlichen Förderer der Virologie in Deutschland und einen wunderbaren Kollegen.
Wir werden Bernhard Fleckenstein in bleibender Erinnerung behalten.
Klaus Überla und Thomas Stamminger

Herr Prof. Dr. Günther Keil
1953 in Großenhain
18. Februar 2020 in Templin
Günther Keil wurde 1953 in Großenhain nahe Dresden geboren und wuchs in Singen am Hohentwiel auf. Er studierte in Konstanz Biologie, wo er 1978 mit einer Diplomarbeit über Kern-assoziierte Proteinkinasen bei Rolf Knippers, dem Nestor molekularbiologischer Forschungmethoden in Deutschland, graduierte. Seine Doktorarbeit fertigte er in Erlangen bei Bernhard Fleckenstein an, wo er sich mit Herpesviren beschäftigte, die dann auch sein künftiges Hauptarbeitsgebiet bleiben sollten. 1981 wechselte er als Laborleiter in die Arbeitsgruppe von Ulrich Koszinowski an die Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere (heute: Friedrich-Loeffler-Institut) nach Tübingen, von wo er 1995 auf die Insel Riems bei Greifswald wechselte.
ährend er in Erlangen an Herpesviren von Primaten arbeitete, setzte er in Tübingen seine molekularbiologischen Untersuchungen mit dem murinen Cytomegalievirus fort. Anschließend richtete er seine Aufmerksamkeit auf bovine Herpesviren. In den letzten Jahren konzentrierten sich seine Forschungsaktivitäten dann auf das Virus der Afrikanischen Schweinepest. Nicht nur diese DNA-Viren, auch RNA-Viren, wie das Hepatitis A-Virus, Pneumoviren, Flaviviren oder Influenza A-Viren gehörten zu seinen Untersuchungsobjekten. Seine Fragestellungen bezogen sich auf virologische, immunologische, methodische und diagnostische Aspekte sowie auf die Entwicklung von Impfstoffen. Besonders interessiert war er an der Aufklärung der Funktion viraler Proteine, an der Verbesserung der Antigenpräsentation zur Stimulierung der T-Zell-Antwort, an der Manipulation viraler Genome zur Attenuierung und an Deletions- und Vektor-Vaccinen. Er war kein Wissenschaftler im Mainstream, aber über 150 Publikationen, darunter in Science und PNAS, belegen seine erfolgreiche wissenschaftliche Arbeit und über 50 Koautoren dokumentieren seine erfolgreiche Einbindung in die Wissenschaftsgemeinde.
Als Direktor und Professor sowie als stellvertretender Leiter des Instituts für molekulare Virologie und Zellbiologie am Riemser Insitut wirkte er an dessen Neuaufbau mit und war für die Biologische Sicherheit verantwortlich. Er war gegenüber seinen Kollegen jederzeit zu Rat und Unterstützung bereit und teilte seine immense Erfahrung selbstlos mit anderen.
Günther Keil bildete eine große Anzahl junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus. Er war für seine Schüler und wissenschaftlichen Weggefährten ein wichtiger Orientierungspunkt. Seine Begeisterung für virologische Fragestellungen war ansteckend und als Experimentator war er ein großes Vorbild. Er erwartete den von ihm gezeigten vollen Einsatz auch von seinen Schülern, hat sie aber immer unabhängig vom Erfolg unterstützt. Man konnte von ihm die kritische Betrachtung von Daten lernen, insbesondere der eigenen, sowie eine gradlinige Haltung. Im Auftreten war er bescheiden und unkonventionell, aber bestimmt. Wir verlieren mit Günther Keil einen engagierten Wissenschaftler, hoch geschätzten Kollegen und guten Freund. Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie und seinen Freunden.
Thomas C. Mettenleiter und Andreas Dotzauer
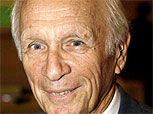
Herr Prof. Dr. Christian Kunz
13. Oktober 1927 in Linz
12. April 2020 in Vöcklabruck
Am Ostersonntag, den 12. April, ist Christian Kunz im 93. Lebensjahr verstorben. Er war der Begründer und langjährige Vorstand des Instituts für Virologie an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien (jetzt Medizinische Universität Wien) und geht als Pionier und prägende Gestalt für die Entwicklung der Virologie in Österreich sowie als Vater des FSME- (‚Zecken‘-) Impfstoffes in die medizinische Geschichte ein.
Christian Kunz wurde am 13. Oktober 1927 in Linz geboren, studierte nach dem zweiten Weltkrieg in Wien und Innsbruck Medizin und trat nach seiner Promotion im Jahr 1954 in das Hygiene-Institut der Universität Wien ein. Zunächst arbeitete er als unbezahlter Gastarzt, dann als wissenschaftliche Hilfskraft. Die Virologie präsentierte sich dem jungen Christian Kunz in den 50er Jahren als ein aufstrebendes Forschungsgebiet mit vielen technologischen Neuerungen und bahnbrechenden Entwicklungen, wie z.B. die Verwendung von Zellkulturen für die Virusvermehrung und die Entwicklung der Polio-Impfstoffe.
Das wissenschaftliche Interesse für die Virologie wurde von seinem Chef, Richard Bieling, gefördert indem er ihm Studienaufenthalte an den damaligen Hochburgen für Virologie in Deutschland bei Spitzenforschern in Freiburg, Tübingen und Marburg ermöglichte. Damit lernte Kunz den in dieser Zeit aktuellsten Stand der modernen Virusforschung kennen und kehrte mit großer Begeisterung (und ausgerüstet mit Zellkulturen für seine wissenschaftliche Arbeit) nach Wien zurück. Genau zu dieser Zeit war es am Wiener Institut gelungen, ein Virus als Erreger der zunächst rätselhaften, im Süden von Wien gehäuft auftretenden sogenannten ‚Schneiderschen‘ Erkrankung zu isolieren. Dieses Virus wurde dann als Frühsommermeningoenzephalitis (FSME)-Virus bezeichnet und stand in weiterer Folge im Zentrum des Forschungslebens von Christian Kunz.
Seine Publikationen fanden bald internationale Beachtung und er wurde eingeladen, seine Forschungensarbeiten an den Rockefeller Laboratories in New York mit einem Stipendium der Rockefeller Foundation fortzusetzen. Er kam somit 1961-62 an eine Forschungseinrichtung, die mit führenden Virologen dieser Zeit geradezu gespickt war, und lernte unter anderen auch Max Theiler kennen, der 1951 für die Entwicklung des Gelbfieber Impfstoffes den Nobelpreis für Medizin erhalten hatte. Dieser Forschungsaufenthalt und der Kontakt mit herausragenden Wissenschaftlern prägten seine weitere Laufbahn.
Zurück in Wien wurde er von Hans Moritsch, dem neuen Vorstand des Hygiene-Instituts, mit der Leitung einer neu etablierten Virusabteilung betraut und baute mit seinem in den USA erworbenen Wissen einen Forschungsschwerpunkt auf dem Gebiet der durch Arthropoden übertragenen Viren (ARBO-Viren) auf. Das FSME-Virus spielte auch in dieser Phase eine zentrale Rolle. Es wurden für die damalige Zeit überaus innovative Techniken der spezifischen Diagnostik entwickelt, der Kreislauf des Virus in der Natur erforscht und die Infektionsorte des Menschen in Österreich (Stichwort ‚Zeckenkarte‘) ermittelt.
Nach dem Tod von Hans Moritsch wurde Heinz Flamm Vorstand des Hygieneinstituts und ermöglichte die Gründung eines eigenen Instituts für Virologie, zu dessen Leiter Christian Kunz als Ordinarius für Virologie im Jahr 1971 ernannt wurde. Seine Arbeiten über die Epidemiologie der FSME verdeutlichten ihm das Ausmaß der FSME als die mit Abstand häufigste virusbedingte Erkrankung des Zentralnervensystems in den Endemiegebieten und veranlassten ihn dazu, seine Kenntnisse für die Entwicklung eines Impfstoffs einzusetzen. Diese Anstrengung, zunächst in Kooperation mit einem englischen Forschungsinstitut und dann später mit dem österreichischen Pharma-Unternehmen Immuno, war von großem Erfolg gekrönt und führte zur Herstellung eines hochwirksamen Impfstoffes. Dessen breite Anwendung bewirkte einen eindrucksvollen Rückgang der FSME in Österreich. Als Anekdote sei erwähnt, dass sich er und sein damaliger Mitarbeiter Hanns Hofmann (der ebenfalls leider bereits verstorben ist) den ersten experimentellen Impfstoff gegenseitig verabreichten und in diesem Selbstversuch nach einigen Wochen mit einiger Erleichterung dessen gute Verträglichkeit feststellen konnten.
Die Entwicklung des FSME-Impfstoffes ist wahrscheinlich die Leistung, mit der der Name Christian Kunz am stärksten verbunden ist. Allerdings ist seine Bedeutung für die Entwicklung der Virologie in Österreich und in Europa wesentlich umfassender, vor allem durch sein engagiertes Wirken im Bereich der Virusdiagnostik und der medizinischen Virologie. Er war 1975 Gründungsmitglied und später jahrelang Chairman der ‚European Group for Rapid Virus Diagnosis‘, einem Zusammenschluss führender medizinischer Virologen aus mehreren europäischen Ländern, die sich vor allem mit der Entwicklung neuer Methoden zur Früherkennung von Virusinfektionen befassten. Damit erlangte die Virusdiagnostik eine neue und für die klinische Betreuung von Patienten relevante Bedeutung. Die Qualität der gesetzten Impulse war herausragend, sodass diese Vereinigung (die seit 1997 in die ‚European Society for Clinical Virology‘ übergegangen ist) damals weltweit eine Vorreiterrolle einnehmen konnte. Christian Kunz war mehrere Jahre Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin und in zahlreichen nationalen und internationalen Gremien ein hochgeschätzter Fachmann, der seinen Sachverstand in den Dienst gesundheitspolitischer Entscheidungen stellte. So trug er Mitte der Achtziger Jahre wesentlich dazu bei, dass beim damals neuen Problem der HIV-Infektionen in Österreich eine Evidenz- und nicht Angst-basierte Herangehensweise gewählt wurde.
Im Jahr 1996 ist Christian Kunz emeritiert, und 2006 wurde er mit der Loeffler Frosch Medaille der internationalen ‚Gesellschaft für Virologie‘ für seine herausragenden Verdienste um die Entwicklung der Virologie im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. In Würdigung seiner besonderen Leistungen hatte er bereits 1988 die Ehrenmedaille in Gold der Bundeshauptstadt Wien erhalten, und er war auch Ehrenmitglied verschiedener nationaler und internationaler Wissenschaftsgesellschaften. Eine seiner großen Fähigkeiten bestand darin, an seinem Institut eine für alle Teile fruchtbare Symbiose von medizinisch-virologischer Forschung und Virusdiagnostik mit der molekularen Grundlagenforschung herbeizuführen. Er tat das als Führungspersönlichkeit in einer Art und Weise, die für seine Mitarbeiter die Arbeit fast immer zum Vergnügen machte. Das war vor allem auf seine stets wohlwollende, unterstützende, fördernde und auf die Fähigkeiten der Mitarbeiter vertrauende Grundhaltung zurückzuführen, sowie auf seinen – auch in schwierigen Zeiten – nie versiegenden und ansteckenden Sinn für Humor. Ich persönlich und viele andere, die das Glück hatten mit ihm zusammenzuarbeiten, sind ihm nicht nur für seine wissenschaftlichen Leistungen, sondern auch für seine Großzügigkeit, menschliche Größe und Freundschaft dankbar.
Franz X. Heinz, oUnivProf. iR, Zentrum für Virologie, Medizinische Universität Wien
Email: Franz.X.Heinz@meduniwien.ac.at

Herr Prof. Dr. Michael F.G. Schmidt
1946
17. Februar 2019
Die Gesellschaft für Virologie trauert um Michael Schmidt, der am 17.02.2019 im 73. Lebensjahr verstorben ist.
Er begann seine wissenschaftliche Karriere in Gießen, wo er nach dem Studium der Biologie am Institut für Virologie bei Christoph Scholtissek über die Glykosylierung viraler Glykoproteine promovierte. Mit Hilfe spezifischer Inhibitoren gewann er Einblicke in die funktionelle Bedeutung dieser Kohlenhydratstrukturen, über die damals noch wenig bekannt war.
Während eines von der DFG im Anschluss geförderten Forschungsaufenthaltes an der Washington University in St. Louis, USA, konnte er erstmals zeigen, dass virale Glykoproteine kotranslational acyliert werden und dass diese Modifikation entscheidend für deren Membranverankerung und Fusionsaktivität ist.
Diese Arbeiten hat er ab 1980 am Gießener Institut fortgesetzt und dort mit der Habilitation für die Fächer Virologie und Biochemie am Fachbereich Veterinärmedizin abgeschlossen. 1986 folgte er einem Ruf auf eine Professur an der Universität von Kuwait, die er in der Folge der Kuwait-Krise 1990 wieder aufgeben musste.
Zurück in Deutschland, übernahm er die Leitung des Instituts für Immunologie und Molekularbiologie des Fachbereichs Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin. Hier führte er mit Erfolg die Untersuchungen zur funktionellen Bedeutung postsynthetischer Modifikationen viraler Hüllproteine weiter und studierte den Einfluss probiotischer Bakterien auf die Immunität und Virusvermehrung. Etliche seiner Publikationen wurden jeweils mehrere hundert Male in der Fachliteratur zitiert.
Stets hat Michael Schmidt auch übergreifende Verantwortung übernommen, so als Dekan seines Fachbereiches an der FU oder in seiner Heimatgemeinde Seddiner See 40 km südwestlich von Berlin: Hier gründete er einen Verein zur Übernahme des stillgelegten Dorfladens, um Versorgung, Kommunikation und Kultur nicht aus dem Ort verschwinden zu lassen.
Alle, die ihn kannten, werden seine ansteckende Fröhlichkeit und Freude an der Wissenschaft in guter Erinnerung behalten.
Hans-Dieter Klenk, Marburg
Detlev H. Krüger, Berlin

Herr Prof. Dr. rer. nat. Nikolaus Müller-Lantzsch
29. März 1943 in Görlitz/Neiße
02. August 2017 in Homburg/Saar
Die Gesellschaft für Virologie trauert um ihren Altpräsidenten Herrn Professor Dr. rer. nat. Nikolaus Müller-Lantzsch
Nikolaus Müller-Lantzsch war bis zu seiner Emeritierung 2009 Inhaber des Lehrstuhls für Virologie am Universitätsklinikum Homburg/Saar.
Nikolaus Müller-Lantzsch gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Gesellschaft für Virologie und war in den Jahren 2005 – 2011 ihr Präsident. Nikolaus Müller-Lantzsch studierte von 1964 bis 1971 Biologie an den Universitäten Hamburg und Freiburg.
Nach der Promotion zum Dr. rer. nat. im Jahre 1974 mit einer Arbeit zur Transkription bei SV40 und Polyomavirus am damaligen Hygiene-Institut (Abteilung Virologie) der Universität Freiburg unter der Leitung von Prof. Richard Haas und Prof. Gerhard Brandner arbeitete Nikolaus Müller-Lantzsch am Salk Institute, La Jolla, CA, USA, über die Funktion virus-spezifischer RNA des Moloney Leukämie Virus. Ab 1976 forschte er als Habilitand am Institut für Virologie der Universität Freiburg unter der Leitung von Prof. Dr. Harald zur Hausen. 1981 erfolgte die Habilitation („Biochemische Charakterisierung Epstein-Barr Virus spezifischer Antigene“) an der Medizinischen Fakultät der Universität Freiburg. In den Jahren 1980-1982 war er Leiter der Abteilung ‚Forschung und Entwicklung Virologie‘ am Schweizerischen Serum- und Impfinstitut in Bern. Nachdem er 1982 auf eine C2 Professur am Institut für Virologie der Universität Freiburg berufen wurde, trat er 1988 eine C3 Professur und die Stelle des Abteilungsdirektors der Abteilung Virologie am Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene, Universität des Saarlandes, Homburg/Saar an. 1995 erfolgte die Ernennung zum C4 Professor. Unter seiner Regie wurden in Homburg ein neues Institutsgebäude errichtet und die Voraussetzungen für die Berufung zum Nationalen Referenzzentrum für γ-Herpesviren geschaffen. In der medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes bekleidete er verschiedene Ämter der akademischen Selbstverwaltung und war u.a. von 1998 bis 2004 Dekan bzw. Studiendekan der Medizinischen Fakultät. Für seine Verdienste hinsichtlich des wissenschaftlichen Austausches mit französischen Kollegen wurde er 2002 vom französischen Premierminister zum „Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques“ ernannt.
Ein Schwerpunkt der Arbeit von Nikolaus Müller-Lantzsch nach 1982 in Freiburg war die molekularbiologische Charakterisierung der EBV-kodierten Proteine EBNA-1, EBNA-2 und LMP und deren Bedeutung für die Biologie von EBV. Dieser Themenkomplex wurde von ihm auch in Homburg mit großem Nachdruck weiterverfolgt und durch sehr umfassende Bemühungen ergänzt, diese Antigene insbesondere für die Diagnostik von EBV-Reaktivierungen nutzbar zu machen. Dabei komplementierten systematische Untersuchungen zur EBV-Viruslast diesen wichtigen Ansatz. In der Freiburger Zeit erwarb sich Nikolaus Müller-Lantzsch sehr große Verdienste um die Etablierung der HIV-Diagnostik. Wegbegleiter aus dieser Zeit werden sich erinnern, dass die ersten Serien von HIV-positiven Präparaten für die HIV–Antikörper-Immunfluoreszenz (insbesondere die in der Transplantationsmedizin notwendigen Schnellteste) von ihm selbst angefertigt wurden, um die Durchführbarkeit und Sicherheit der Präparation zu evaluieren und zu demonstrieren. Erwähnenswert ist auch, dass die EDV-gestützte Virusdiagnostik in Freiburg von ihm maßgeblich konzipiert und etabliert wurde.
Neben Untersuchungen zu EBV legte er ab 1993 den Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeiten auf die Erforschung humaner endogener Retroviren. Ihm gelang in einer grundlegenden Arbeit der Nachweis, dass das humane endogene Retrovirus HERVK (HML-HOM) vollständige offene Leseraster aufweist. In weitergehenden Arbeiten konnte er zeigen, dass Patienten mit Keimzelltumoren Antikörper gegen virale Proteine entwickeln und dass die Tumorzellen die viralen Gene exprimieren. In Mausexperimenten konnte schlussendlich das onkogene Potential HERVK-kodierter Proteine demonstriert werden. Eine Vielzahl an nationalen und internationalen Kooperationen dokumentieren den hohen wissenschaftlichen Wert dieser Arbeiten. Die Kollaboration mit Wissenschaftlern der DDR sowie aus Russland lag ihm besonders am Herzen. Im Laufe seiner Tätigkeit betreute er eine Vielzahl von Diplom-, Doktor- und Habilitationsarbeiten. Neben seiner Forschungstätigkeit und der Arbeit in verschiedenen Fachgremien war ihm die Etablierung und fortlaufende Verbesserung neuester diagnostischer Analysemethoden im Rahmen der Patientenversorgung ein wichtiges Anliegen.
Nikolaus Müller-Lantzsch war in der Virologie nicht nur als Wissenschaftler hoch geachtet, sondern auch als Kollege und Freund äußerst geschätzt und beliebt. Er hatte immer mehr im Blick als seine eigenen Forschungsthemen und seine persönlichen Erfolge. Seine Fähigkeit war es, das Ganze zu sehen, Verantwortung zu suchen und Führung zu übernehmen. Dies machte ihn zu einem bedeutenden Lehrstuhlinhaber und einem hervorragenden Präsidenten. Wir werden ihn in bleibender Erinnerung behalten.
Friedrich Grässer, Homburg
Georg Bauer, Hartmut Hengel und Dieter Neumann-Haefelin, Freiburg

Herr Prof. Dr. Reinhard Kandolf
10. September 1948
31. März 2017 in Tübingen
Ein Forscher am Herzen
Nachruf: Der Virologe, Pathologe und gebürtige Pfälzer Reinhard Kandolf starb völlig unerwartet im Alter von nur 68 Jahren.
Prof. Reinhard Kandolf war Leiter der Molekularen Pathologie in Tübingen. Sein Arbeitsgebiet war die virale Myokarditis
(insbesondere Picornaviren). Am 31. März 2017 verstarb in Tübingen völlig unerwartet Prof. Reinhard Kandolf, Ärztlicher Direktor der Abteilung für Molekulare Pathologie am Universitätsklinikum Tübingen.
Reinhard Kandolf war am 10. September 1948 in der Oberpfalz zur Welt gekommen. Nach dem Besuch eines humanistischen Gymnasiums studierte er Medizin an den Universitäten Erlangen und München. Sein Interesse für die Forschung am Herzen wurde im Rahmen seiner Promotion an der Medizinischen Klinik I der Universität München bei Professor Gerhard Riecker geweckt. Als Stipendiat und späterer wissenschaftlicher Mitarbeiter am MaxPlanck- lnstitut (MPI) für Biochemie in Mattinsried in der Abteilung für Virusforschung (1981-1993) bei Professor Peter Hans Hofschneider gelang es ihm erstmals Coxsackievirus B3, ein häufiger Erreger einer Herzmuskelentzündung, zu klonieren.
1988 erhielt er nach seiner Habilitation für Experimentelle Medizin an der Medizinischen Fakultät der Universität München eine Stiftungsprofessur für Medizinische Forschung am MPI in Martinsried und erwarb dann den Facharzt für Biochemie. 1993 wechselte er als C3-Professor für Molekulare Pathologie nach Tübingen. Dem folgte ein Ruf als Ärztlicher Direktor auf die neu gegründete C4-Professur für Molekulare Pathologie der Universität Tübingen im Jahre 1997, die er bis zu seinem plötzlichen Tod innehielt.
Sein wissenschaftlicher Schwerpunkt lag auf dem Gebiet der Kardiopathologie. Er publizierte zusammen mit seiner Arbeitsgruppe und zahlreichen nationalen und internationalen Ko-Operationspartnern 300 wissenschaftliche Arbeiten, vielfach in hochrenommierten wissenschaftlichen Zeitschriften. Sein wissenschaftliches Wirken wurde durch verschiedene Auszeichnungen wie etwa dem Max-Planck-Forschungspreis für internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Virusätiologie kardiovaskulärer Erkrankungen sowie durch die Verleihung einer Gastprofessur an der Universita degli Studi di Roma Tor Vergata geehrt.
Reinhard Kandolf war zudem viele Jahre mit den Deutschen Gesellschaften für Pathologie, Kardiologie und Pädiatrischen Kardiologie eng verbunden. In der Medizinischen Fakultät Tübingen war er über viele Jahre in verschiedenen Positionen aktiv.
Mit dem Tod von Reinhard Kandolf verliert das Universitätsklinikum Tübingen, die deutsche Pathologie und Kardiologie einen außergewöhnlichen Menschen, eine prägende Persönlichkeit und einen hervorragenden Wissenschaftler. In seiner menschlichen Weise hat Reinhard Kandolf als Mentor viele Studentinnen und Studenten auf ihrem Weg in die Forschung und Patientenversorgung begleitet. Alle, die ihn kannten, werden ihn in dankbarer Erinnerung behalten.
Prof. Karin Klingel,
stellvertretende Ärztliche Direktorin,
Abteilung Molekulare Pathologie
Universitätsklinikum Tübingen
Weitere Quellen:
Prof. Thomas Mertens, Universitätsklinikum Ulm
Bild: Archivbild Universitätsklinikum Tübingen

Herr Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Marian Horzinek
3. Oktober 1936 in Kattowitz
28. Juli 2016
Nachruf Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Marian Horzinek
Prof. Marian Horzinek war ein kostbares Exemplar der schon nahezu vergessenen Spezies des polyglotten und weltgewandten Universal-Gelehrten.
Er studierte Veterinärmedizin in Giessen und Hannover. Nach Zwischenstationen in Venezuela und Tübingen übernahm er die Departmentsleitung und Professur für Virologie und Viruserkrankungen an der Universität Utrecht, wo er in weiterer Folge das Institut für Veterinärforschung sowie die Graduiertenschule für Tiergesundheit leitete.
Prof. Horzinek`s Forschung befaßte sich mit vielfältigen Aspekten von Virologie, Immunologie und Vakzinologie und fand ihren Niederschlag in mehr als 300 Publikationen und 30 Fachbücher. Seine besondere wissenschaftliche Aufmerksamkeit galt dabei Coronaviren und Infektionen bei Katzen. Darüber hinaus war er ein exzellenter Lehrer mit zahlreichen erfolgreichen Schülern – so war sein allererster Doktorand der renommierte Virologe Prof. Albert Osterhaus und seine Mitarbeiter wurden auf mehr als 10 Lehrstühle für Virologie berufen. Auch die Verfasser dieses Nachrufs sind Prof. Horzinek zu Dank verpflichtet.
Neben Gastprofessuren an der Cornell University und der University of California Davis wurde Prof. Horzinek mit Ehrendoktoraten (Gent, Hannover, Uppsala, Wien, Guelph) sowie einer Vielzahl weiterer Preise ausgezeichnet. Er fungierte als Editor, Präsident und Gründungsmitglied von mehreren veterinärmedizinischen Fachorganisationen und Zeitschriften. Zusätzlich brachte er als langjähriger Vorstand der Wissenschaftlichen Beiräte von Universitäten in Wien und Barcelona seine wertvolle Erfahrung ein.
Prof. Horzinek konnte vortrefflich philosophieren und pointiert und sprachgewandt komplexe und auch kontroversielle Themen aufbereiten. Als Veterinärmediziner und Wissenschafter war es ihm dabei ein besonderes Anliegen, Klinik und Forschung näher zusammenzurücken und die Trommel für eine Fakten-basierte Medizin zu schlagen. In diesem Sinne war er ein früher Vorreiter und wortgewaltiger Advokat für die heute sich in aller Munde befindliche “Precision Medicine”. Sein Weitblick, sein immenser Wissenshorizont, sein kritisch-konstruktiver Geist und nicht zuletzt auch sein verschmitzter und außergewöhnlicher Humor voller etymologischer Anspielungen, Anekdoten und Poesie bleiben unvergessen.
Dr. med. vet. Andreas Bergthaler
CeMM Forschungszentrum für Molekulare Medizin, Wien
Dr. med. vet. Andreas Pichlmair
Max Planck Institut für Biochemie, München
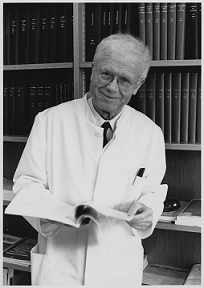
Herr Prof. Dr. med. Hans Joachim Eggers
26. Juli 1927 in Baumholder-Nahe
05. Mai 2016 in Köln
Die Gesellschaft für Virologie trauert um
Herrn Professor Dr. med. Hans Joachim Eggers
Hans Joachim Eggers war bis zu seiner Emeritierung 1994 Inhaber des Lehrstuhls für Virologie der Universität zu Köln.
Hans Joachim Eggers war ein bedeutender Virologe „der ersten Stunde“ in Deutschland. Bereits während seiner Tätigkeit in den Vereinigten Staaten gehörte er zu den Begründern der Forschung auf dem Gebiet der selektiven antiviralen Therapie (1963). Zahlreiche Publikationen zur antiviralen Chemotherapie und Resistenzbildung gingen aus diesen Arbeiten hervor, in denen auch die Hypothese formuliert wurde, dass zur Verminderung der Resistenzselektion die Kombination zweier Substanzen gegen unterschiedliche Zielstrukturen anzuwenden sei.
Weiterhin gehen wesentliche grundlegende, erstmalig molekularbiologisch gewonnene Erkenntnisse zur RNA- und Proteinsynthese bei Picornaviren (insbesondere Polioviren), zu Pathogenitätsfaktoren und zur Entstehung des zytopathischen Effekts auf seine Forschungsergebnisse zurück. Als Virologe und Arzt hat er auch regelmäßig klinisch-virologische Fragestellungen bearbeitet. Die hohe internationale Anerkennung seiner Arbeiten findet ihren Ausdruck nicht zuletzt in der Tatsache, dass von seinen etwa 200 Publikationen 26 in den besten fachübergreifenden Journalen (Nature, Science, PNAS, J Exp Med, Lancet) erschienen sind.
Geboren in eine Pfarrersfamilie in Baumholder, studierte Hans Joachim Eggers nach dem Abitur in Sobernheim von 1947-1953 Medizin an den Universitäten Köln und Heidelberg. Seine wissenschaftliche Arbeit begann er in der Biochemie Köln als Doktorand von Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Ernst Klenk. Die Liebe zur Virologie wurde bereits während seiner Arbeit an der Universitätsnervenklinik Köln (1953-1957) geweckt. Unterbrochen wurde diese erste Zeit in Köln durch einen Studienaufenthalt (Polio-Neutralisation) am Karolinska Institut (Prof. Dr. Sven Gard), Stockholm, und eine „Pflichtassistentenzeit“ in Hamburg (klinische Bakteriologie und Serologie). Von 1957 bis 1959 war er als Stipendiat der Children´s Hospital Research Foundation in Cincinnati, Ohio, bei Prof. Dr. Albert B. Sabin und danach als Research Associate bei Prof. Dr. Frank L. Horsfall, Jr. und Prof. Dr. Igor Tamm am Rockefeller Institute, New York. Ebendort war er von 1961-1964 Assistant Professor. 1965 erfolgte die Rückkehr mit seiner Frau Gisela und den 3 Kindern Carsten, Jens und Susanne nach Deutschland, wo er von 1965-1966 Abteilungsleiter am MPI für Virusforschung in Tübingen war. 1966 folgte er dem Ruf auf den Lehrstuhl für Virologie der Justus Liebig-Universität Gießen und 1972 dem Ruf auf den ebenfalls neu gegründeten Lehrstuhl für Virologie an der Universität zu Köln. Nach seiner Emeritierung war er Gastprofessor für Virologie am Institute for Molecular Virology in Madison, Wisconsin.
Hans Joachim Eggers war höchst aktives Gründungsmitglied und Ehrenmitglied unserer Gesellschaft und Mitglied zahlreicher weiterer wissenschaftlicher Gesellschaften, unter diesen auch Senatsmitglied der Leopoldina.
Jeder, der Prof. Eggers kannte, vor allem auch seine Schüler, schätzte ihn als hervorragenden Wissenschaftler, der dieser Berufung stets mit größter Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit folgte. Wir verlieren mit Hans Joachim Eggers aber auch einen hochgebildeten (Mozartexperte), liebenswerten Menschen und stets engagierten und diskussionsfreudigen Kollegen und Freund. Er bleibt in unserem Gedächtnis.
Die Trauerfeier ist am 21. Mai um 10.30 Uhr in der Trauerhalle des Friedhofes Melaten, Eingang Piusstraße, 50931 Köln. Anschließend ist die Beisetzung.
Thomas Mertens
Präsident der GfV
Herr Prof. Dr. Jean Lindenmann
18. September 1924 in Zagreb
15. Januar 2015
Prof. Dr. Jean Lindenmann
Die Erstbeschreibung des Interferons im Jahre 1957 durch Jean Lindenmann und Alick Isaacs ist ein Meilenstein in der biomedizinischen Forschung. Jean Lindenmann starb am 15. Januar 2015, wenige Monate nach seinem 90. Geburtstag, den er mit engen früheren Mitarbeitern am Zürichsee feiern konnte.
Jean Lindenmann wurde am 18. September 1924 in Zagreb, Jugoslawien (heutiges Kroatien) geboren.
Er erwarb die Matura Typ C an der Oberrealschule in Zürich und studierte an der Universität erst Physik dann Medizin. Der Abwurf der Atombombe über Hiroshima hatte ihn bewogen, das Studium zu wechseln. Anschließend war er Assistent am Hygiene-‐Institut der Universität unter Prof. Hermann Mooser. Neben bakteriologisch-diagnostischer Tätigkeit befasste er sich bereits damals mit der Virusinterferenz, wobei die Infektion mit einem ersten Virus vor einer Zweitinfektion mit demselben oder einem ganz anderen Virus schützt. Die vorherrschende Meinung war, dass die Erstinfektion wichtige Bestandteile in der infizierten Zelle blockieren oder aufbrauchen würde, die dann dem Zweitvirus nicht mehr zur Verfügung stünden. Der angehende Forscher fand in eigenen, genialen Experimenten, dass das wohl nicht zutraf.
1956 erhielt er ein Stipendium der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften, um sich in London am National Institute for Medical Research in Mill Hill für ein Jahr ganz der Virologie zu widmen. Er begann unter C.H. (später Sir Christopher) Andrewes ein Projekt über Polioviren und traf eines Tages überraschend auf Alick Isaacs, der im Nachbarlabor über Virusinterferenz forschte. Die beiden begannen eine intensive Zusammenarbeit, die innerhalb weniger Monate in der Entdeckung des Interferons gipfelte. Sie fanden, dass das erste Virus die infizierten Zellen zur Ausschüttung einer zelleigenen Substanz veranlasst, welche als Botenstoff benachbarte Zellen vor Neuinfektion schützt. Der Name Interferon ist übrigens Lindenmann’s alter Liebe zur Physik und ihren Elektrons, Myons und Mesons geschuldet. Interferon mit seinen vielfältigen antiviralen, antitumoralen und immunmodulatorischen Wirkungen wurde eine Erfolgsgeschichte.
Jean Lindenmann kehrte vorerst als Oberassistent ans Hygiene‐Institut in Zürich zurück und nahm 1960 eine Anstellung als „Bakteriologe zweiter Klasse“ am damaligen Eidgenössischen Gesundheitsamt in Bern an. Dort entdeckte er dank glücklicher Umstände, dass es bei gewissen Labormäusen eine vererbbare Resistenz gegen Influenzavirusinfektionen gibt. Initial dachte er an eine besonders gute Immunantwort. Später wurde klar: es war schon wieder Interferon. Das Resistenzgen (MX1) wird durch Interferon angeschaltet. Es kommt natürlicherweise auch beim Menschen vor, zusammen mit einem zweiten Gen (MX2), das Bestandteil der Interferonantwort gegen HIV-‐1 ist. Ab 1962 arbeitete Jean Lindenmann als Visiting Assistant Professor am Department of Microbiology der University of Florida in Gainesville, wo er bahnbrechende Arbeiten zur viralen Onkolyse und postonkolytischen Immunität begann. 1964 wird er als Extraordinarius für Experimentelle Mikrobiologie an die UZH berufen, 1969 zum Ordinarius befördert und 1980 zum Ordinarius für Immunologie und Virologie und Direktor des gleichnamigen Institutes ernannt. Das Institut wird ein Eldorado des kreativen Denkens und Forschens.
Jean Lindenmann war ein begnadeter akademischer Lehrer, der seine Zuhörer zu fesseln verstand. Dank einer natürlichen Neugier war er allem Neuen zugewandt. So entstand ein innovatives Lehrbuch für Anfänger im Fach Immunologie, das im Stil eines modernen Lernprogramms aufgebaut war. Er verstand es auch trefflich, sich klar zu aktuellen Fragen der Medizin und Naturwissenschaften an eine breite Öffentlichkeit zu wenden. Er war Mitglied des Forschungsrats des Schweizerischen Nationalfonds und vieler weiterer Gremien. Er erhielt zahlreiche Ehrungen, so den Georg-Friedrich-Götz-Preis 1969, den Schweizer Krebspreis 1964 und 1987 (zusammen mit Charles Weissmann), den Robert-Koch-Preis 1973, den Marcel-Benoist-Preis 1977 und den European Virology Award der Europäischen Gesellschaft für Virologie 2007.
Nach seiner Emeritierung konnte sich Jean Lindenmann ganz seinen vielfältigen Interessen in Literatur, Kunst und Musik hingeben. Er befasste sich vertieft mit historischen und soziologischen Aspekten der Wissenschaft und hatte kein Verständnis für die extreme Ansicht gewisser Soziologen, die argumentierten, dass wissenschaftliche Fakten bloß auf sozialen Übereinkünften beruhen würden. In seinem letzten autobiographischen Werk schrieb er: „Thus, I am outing myself as a naive realist. Sociologists and philosophers of science will dismiss me as an old fool. Too bad – tant pis pour moi – it was great fun“. Er wird uns in bleibender Erinnerung bleiben, nicht als Tor,
sondern als eine außergewöhnlich kreative und auch kritische Persönlichkeit mit viel Sinn für Humor.
Otto Haller

Herr Prof. Dr. Axel Rethwilm
3. August 1959 in Bielefeld
29. Juli 2014
Die Gesellschaft für Virologie trauert um Herrn Professor Dr. Axel Rethwilm
Axel Rethwilm, Inhaber des Lehrstuhls für Virologie an der Universität Würzburg, ist in der Nacht zum 29. Juli im Alter von nur 54 Jahren verstorben.
Geboren wurde Axel Rethwilm am 3. August 1959 in Bielefeld. Er studierte Humanmedizin an der Universität Freiburg. Nach seiner Promotion begann er 1985 in der Abteilung Virusforschung am DKFZ Heidelberg seine wissenschaftliche Laufbahn.
Im Jahr 1987 wechselte er an das Institut für Virologie und Immunbiologie der Universität Würzburg. Die Habilitation im Fach Virologie folgte 1992 und seine Berufung zum C3-Professor für Retrovirologie im Jahre 1995. Von 1998 bis 2003 war er Direktor des Instituts für Virologie der Technischen Universität Dresden. Anschließend übernahm er den Lehrstuhl für Virologie des Instituts für Virologie und Immunbiologie der Universität Würzburg.
Axel Rethwilm widmete sich zunächst den Foamyviren. Ihm gelang die erste molekulare Klonierung und Charakterisierung eines Foamyvirusgenoms. Es schlossen sich wegweisende wissenschaftliche Arbeiten zu verschiedenen Aspekten des Infektionszyklus von Foamyviren an, unter anderem zu Infektionsvorgang und Tropismus, zur Replikation des viralen Genoms und zum Zusammenbau des viralen Partikels. Daneben entwickelte Axel Rethwilm schon sehr früh ein besonderes wissenschaftliches Interesse hinsichtlich der Entwicklung und Verwendung von Foamyviren als Vektorplattform für Anwendungen im Rahmen der somatischen Gentherapie.
Virologische Grundlagenwissenschaft, anwendungsorientierte Forschung und auch klinisch virologische Aspekte, machten ihn zu einem international sehr anerkannten Wissenschaftler und Hochschullehrer.
Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses war ihm sehr wichtig. Dabei lag ihm besonders die Kooperation mit Universitäten in Afrika und die Nachwuchsförderung dort am Herzen. Er war Sprecher des ersten deutsch-afrikanischen Graduiertenkollegs, in dem herausragende Nachwuchsforscher aus Deutschland und Afrika am Thema „HIV, AIDS und damit assoziierte Infektionskrankheiten“ arbeiteten. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft förderte das Kolleg seit 2008.
Axel Rethwilm war ein, auch im Beirat unserer Gesellschaft, sehr aktives Mitglied der GfV. Alle, die ihn persönlich kannten, schätzten seine stets aufrichtige, unkonventionelle, diskussionsfreudige und dabei stets freundliche Art.
Wir nehmen Abschied von einem hervorragenden Wissenschaftler, und hochgeschätzten Kollegen und Freund.
Die Beisetzung seiner Urne erfolgt am 26.September um 13:oo Uhr auf dem Waldfriedhof in Würzburg.

Herr Professor Karl Eduard Schneweis
24. April 1925 in Koblenz
7. Februar 2014
Die Gesellschaft für Virologie betrauert den Tod von Professor Karl Eduard Schneweis (Bonn). Der 1925 in Koblenz Geborene gehörte der Gründergeneration der Medizinischen Virologie in Deutschland an. Nach seinem Medizinstudium in Bonn und Göttingen war er Assistenzarzt am Medizinaluntersuchungsamt Hannover und am Hygieneinstitut Hamburg.
Am Max Planck Institut für Gewebezüchtung in Berlin-Dahlem erarbeitete er neue Zellkulturtechniken mit einem besonderen Augenmerk auf Histokompatibilitätsantigene. Ab 1959 baute er an der Universität Göttingen die virologische Diagnostik auf. Dabei gelang ihm die serologische Differenzierung von Herpes Simplex Viren und die erstmalige Unterscheidung der beiden menschlichen Simplex-Virustypen. Professor Schneweis kommt deshalb der herausragende Verdienst der Entdeckung des Herpes Simplex Virus Typ 2 zu.
Im Jahr 1968 wurde er nach Bonn an das damals von Henning Brandis geleitete Institut für Medizinische Mikrobiologie und Immunologie berufen. Die Universitätsklinik der damaligen Bundeshauptstadt bekam dadurch erstmals eine virologische Abteilung. In den 1970er Jahren etablierte er in Bonn eine leistungsfähige und hoch angesehene medizinische Virologie, deren Forschungstätigkeit das klinische Bild und die Behandlung von Herpesvirusinfektionen zum Hauptgegenstand hatte. In den 1980er Jahren wurde die klinische Virologie der HIV-Infektion zu einem weiteren Arbeitsfeld der Bonner Virologie. Das Labor von Professor Schneweis war unter den ersten Einrichtungen deutschlandweit, die eine lückenlose HIV-Diagnostik anbieten konnten. Die Therapiekontrolle beim Einsatz früher HIV-Medikamente erfolgte zunächst durch Zellkulturversuche und wurde später auf molekularbiologische Verfahren umgestellt.
Karl Eduard Schneweis war ein gefragtes Mitglieder vieler maßgeblicher Gremien, Arbeitsgruppen und Fachgesellschaften. Bis zu seinem Dienstende leitete er in Bonn das Nationale Referenzzentrum für Herpesviren. Er beriet Ministerien und Einrichtungen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und bildete als akademischer Lehrer Generationen von Studendierenden und Graduierten aus.
Wir verlieren mit Karl Eduard Schneweis einen liebenswürdigen und hochgeachteten Kollegen, Mentor und Freund.

Herr Professor Reinhard Kurth
30. November 1942 in Dresden
2. Februar 2014 in Berlin
Am 2. Februar 2014 verstarb der Virologe und Arzt Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Kurth nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren. Er war ein frühes Mitglied der Gesellschaft für Virologie (GfV).
Reinhard Kurth verschrieb sich nach seiner Approbation zum Arzt zunächst ganz der virologischen Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Immunbiologie und Pathogenese von Retroviren.
Als zu Beginn der Achtzigerjahre des letzten Jahrhunderts ein humanes Retrovirus (HIV) als Erreger von AIDS identifiziert wurde, hat sich Reinhard Kurth damals als Leiter der Abteilung Virologie des Paul Ehrlich-Instituts mit großem Engagement auch in die Arbeit der klinischen Virologie und der Bekämpfung der Viruskrankheiten eingebracht und maßgeblich an der schnellen Etablierung der ersten Teste zum Nachweis von HIV-Infektionen mitgewirkt.
Im Rückblick lässt sich wohl sagen, dass dies der Moment in seinem Leben war, der ihn hinlenkte zu seiner herausragenden Tätigkeit als wissenschaftlich geprägter Gestalter im Gesundheitssystem, der „Public Health eben nicht als Etikett, sondern als wissenschaftliche Herausforderung gesehen hat“ – wie Joachim Müller-Jung es in seinem Nachruf in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung formulierte.
In diesem Sinne hat Reinhard Kurth als Virologe zunächst in seiner Eigenschaft als Präsident des Paul Ehrlich-Instituts, dann als Präsident des Robert Koch-Instituts diese Bundesinstitute im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit strukturiert, geleitet und bis weit in die Zukunft hinein geprägt.
Reinhard Kurth war es aber auch immer ein wichtiges Anliegen, die Bevölkerung umfassend und mit verständlichen Worten zu unterrichten, in Krisensituationen aufzuklären und durch kompetente Information zu beruhigen. Wie kein anderer hat er die gesundheitspolitischen Aspekte der Virologie nach außen getragen und ihnen die angemessene Wahrnehmung verschafft.
Die beiden virologischen Fachgesellschaften, die Gesellschaft für Virologie und die Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV) hatten in ihm immer einen hervorragenden, verständigen und verlässlichen Partner, wenn es um die Belange der wissenschaftlichen und klinischen Virologie ging und zollen ihm großen Dank und Anerkennung.
Frau Privatdozentin Dr. med. Regina Allwinn
1. Mai 1961
25. November 2013 in Berlin
Wir trauern um unser GfV Mitglied und geschätzte Kollegin
Privatdozentin Dr. med. Regina Allwinn
die nach schwerer Krankheit im Alter von 52 Jahren am 25. November 2013 verstorben ist.
Wir verlieren mit Frau Dr. Allwinn eine liebenswerte Kollegin, die sich als Oberärztin und Leiterin der reisemedizinischen Impfambulanz über 17 Jahre am Universitätsklinikum Frankfurt mit großem Engagement für das Wohl der Patienten eingesetzt hat.
Der Beratung von Reisenden in der Impfambulanz und der Erforschung von Tropenviren galt ihre besondere Leidenschaft. Die Synthese aus Virologie und Reisemedizin wie auch die Verknüpfung von Familie und Beruf hatten für Frau Dr. Allwinn einen hohen Stellenwert. Mit ihr verlieren wir nicht nur eine hervorragende klinische Virologin, sondern auch eine humorvolle und lebensfrohe Kollegin, die uns durch ihre ehrliche und direkte Art oft zeigte, auf was es in der Infektionsmedizin und im Leben wirklich ankommt.
Wir sind betroffen und empfinden tiefe Trauer.
Für die Gesellschaft für Virologie (GfV)
Prof. Dr. med. Thomas Mertens
Präsident

Kontakt
Fragen, Feedback und Wünsche können Sie per Mail (geschaeftsstelle@g-f-v.org) oder mit dem Kontaktformular an uns adressieren.