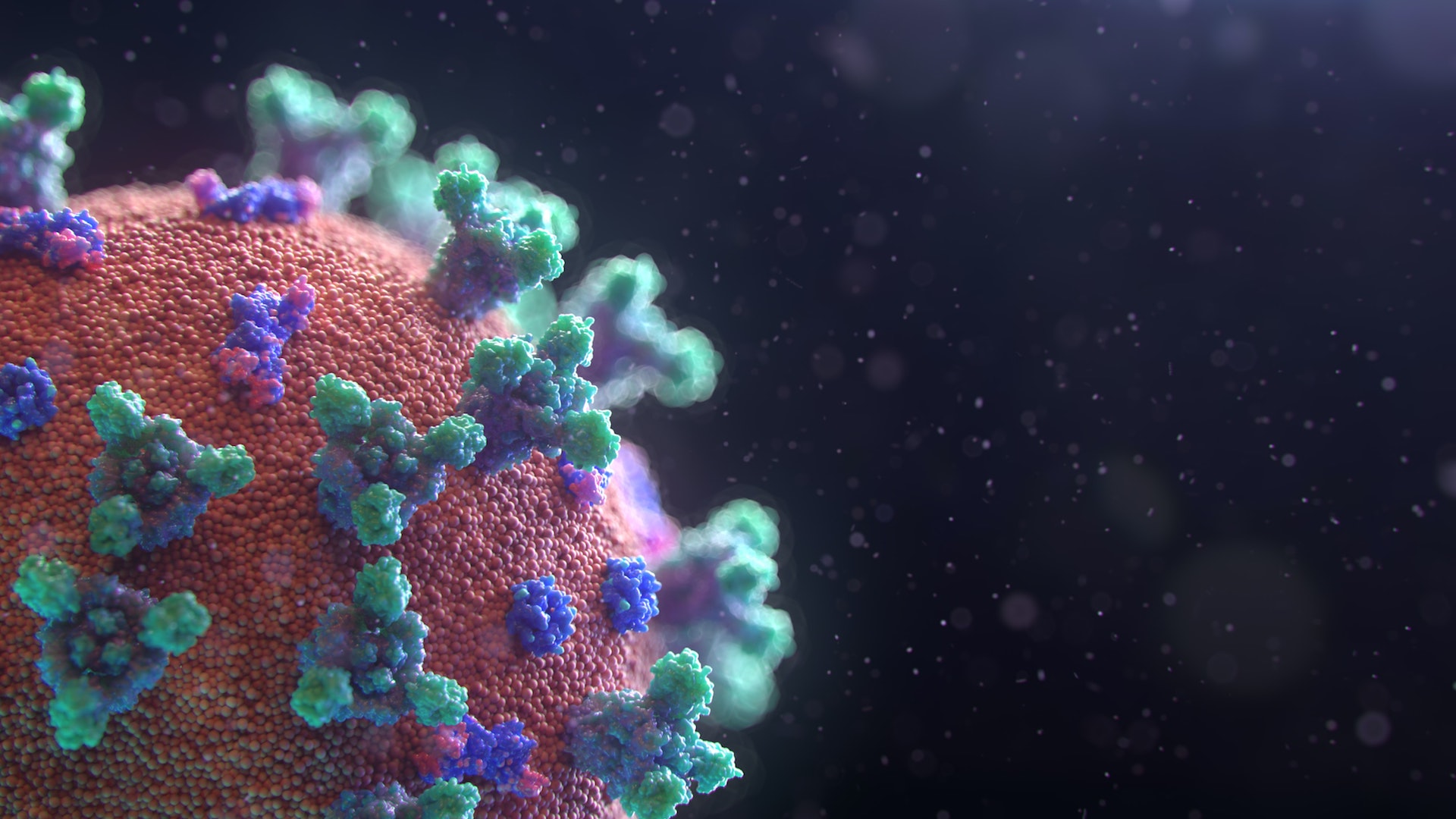Fünf Jahre COVID-19: Anmerkungen der Gesellschaft für Virologie zur Aufarbeitung der COVID-19 Pandemie in Deutschland
27/03/2025
Fünf Jahre COVID-19: Anmerkungen der Gesellschaft für Virologie zur Aufarbeitung der COVID-19 Pandemie in Deutschland
Fünf Jahre nach Beginn der COVID-19 Pandemie ist die Bedrohungslage durch ein für die gesamte Menschheit neues luftübertragenes Virus weitgehend überstanden. In der gesellschaftlichen Debatte kommt es dagegen zu zunehmenden Verzerrungen wissenschaftlicher Fakten und zeitlich-inhaltlicher Bezüge. Hiervon betroffen sind insbesondere die ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens und die Impfung.
Die Vernachlässigung wissenschaftlicher Argumentationsstandards in Teilen der öffentlichen Diskussion und der Einfluss von politisch motivierten Meinungsäußerungen hat das Vertrauen der Bevölkerung in wissenschaftliche Entscheidungsgrundlagen der Politik beeinträchtigt. Die Gesellschaft für Virologie (GfV) e.V. beobachtet diese Entwicklung mit Sorge, denn sie erschwert eine objektive wissenschaftliche Aufarbeitung der Pandemie.
Eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Evidenzlage zu den Pandemie-Kontrollmaßnahmen ist im Gange und wird von der GfV sehr begrüßt. An diesem Prozess beteiligen sich neben der Virologie zahlreiche weitere wissenschaftliche Fachdisziplinen. Die Sichtung und Berücksichtigung des wissenschaftlichen Erkenntnisstands ist die unerlässliche Grundlage für eine politische Bewertung. Daher möchten wir im Folgenden eine Reihe von wissenschaftlichen Erkenntnissen ansprechen und einordnen. Wir möchten auf ausgewählte Punkte hinweisen, die nach unserer fachlichen Einschätzung in Teilen der Öffentlichkeit falsch oder erheblich verzerrt wahrgenommen und wiedergegeben werden und die aktuelle gesellschaftliche Diskussion dadurch nachteilig beeinflussen.
Anfängliche Bewertung der Bedrohlichkeit von COVID-19
Zu Beginn der Pandemie kam es zu teilweise voreiligen Bewertungen hinsichtlich der Gefahrenlage durch das damals neue Virus. Zur Bewertung waren zunächst Schätzungen der Sterblichkeit erforderlich. Der Begriff der Sterblichkeit selbst war während der Pandemie ein häufiger Gegenstand von Verwechslungen. Während eine bevölkerungsweite Prognose nur aus der Infektionssterblichkeit (krankheitsbezogene Sterblichkeit oder auch infection fatality rate (IFR) genannt) abgeleitet werden kann, ist dieser Parameter nicht ohne Weiteres durch direkte Meldedaten zu bestimmen. Der Grund liegt in der Dunkelziffer, d.h. dem Anteil nicht erkannter Infektionen in der Bevölkerung. Meldedaten berücksichtigen die Dunkelziffer nicht und schätzen daher gerade zu Beginn einer Pandemie die Sterblichkeit zu hoch ein. Die auf Meldedaten beruhende Fallsterblichkeit (auch Letalität oder case fatality rate (CFR) genannt) ist eine Momentaufnahme, die stark von der Testhäufigkeit abhängt. Sie ist für die Einschätzung der Pandemieschwere zu fehleranfällig, wurde aber dennoch häufig für Vergleiche herangezogen, etwa indem der Wert der CFR der saisonalen Grippe – oft im Bereich von 0,1% gelegen – mit vorläufigen Schätzungen der IFR von COVID-19 verglichen wurde. Der CFR-Wert von COVID-19, der eigentlich zum Vergleich hätte herangezogen werden müssen, lag aber Anfang März 2020 in Europa bei 2,4%, weltweit bei 3,4% (Robert Koch-Institut 2020a).
Der maßgeblichere Wert der IFR muss durch statistische Schätzungen ermittelt werden. Diese Schätzungen basieren in der modernen Infektionsepidemiologie auf detaillierten Modellierungsanalysen. Modellierungsanalysen gerieten während der Pandemie oft in die Kritik, wobei sie teils als hypothetisch oder irreal dargestellt wurden. Hierdurch erfolgte eine Aufweichung der maßgeblichen wissenschaftlichen Argumentationsgrundlage zur Bewertung der Pandemieschwere.
Bereits frühzeitig in der Pandemie, während der ersten Welle, lagen valide Modellierungen der IFR vor, welche im Bereich von 0,7 bis 1% angesiedelt waren (Dorigatti et al. 2020; Verity et al. 2020) International übergreifende Schätzungen für verschiedene Länder lagen bereits im Sommer 2020 vor und schätzten die IFR für Deutschland erneut im Bereich von knapp 1% ein (O’Driscoll et al. 2021). In Spanien wurde die IFR durch sehr große Antikörperuntersuchungen direkt ermittelt, das Ergebnis bestätigte die Präzision der länderübergreifenden Modellierung (Pastor-Barriuso et al. 2020). Auch Vergleiche von anderen direkten Untersuchungen zur Bestimmung der IFR in der ersten Pandemiewelle bestätigen insgesamt die länderspezifischen Schätzungen durch Modellierung (Levin et al. 2020). Eine deutlich niedrigere IFR wurde in einer Länder übergreifenden Arbeit von Ioannidis berichtet (Ioannidis 2021). Für Deutschland wird dabei eine IFR von 0,26% bzw. 0,28% angegeben. Die Berechnungen beruhen dabei auf zwei sehr frühen Studien (April 2020) zur Seroprävalenz in Heinsberg (Streeck et al. 2020) und Mitarbeitern eines Betriebs in Frankfurt (Krähling et al. 2020) Beide Studien sind aber nicht repräsentativ für die deutsche Bevölkerung und die von Ioannidis für Deutschland berechneten IFRs beruhen auf Extrapolationen von nur 7 Todesfällen in der Heinsberg-Studie und 5 Seropositiven in der Frankfurter-Studie.
Dagegen bestätigt eine vor kurzem erschienene Studie aus Österreich nochmals unabhängig, dass in der Winterwelle 2020/2021, die dortige IFR zwischen 0,5% und 1% lag (Riedmann et al. 2025). Dieser Schätzbereich entsprach demjenigen für England im gesamten Jahr 2020 (Eales et al. 2023). Es besteht insgesamt aus wissenschaftlicher Sicht kein Anhaltspunkt dafür, die anfänglichen Schätzungen der Pandemieschwere im Nachhinein in Zweifel zu ziehen. Die IFR für saisonale Influenza liegt im Vergleich dazu bei unter 0,1%, in den USA beispielsweise bei 0,04 bis 0,08% (Levin et al. 2020). Hieraus ergibt sich eine grobe und konservative Schätzung einer etwa 10 bis 20-fach höheren IFR für die pandemische Phase von COVID‑19 im Vergleich zu saisonaler Influenza (Annahme: IFR Influenza 0,05%, COVID-19 0,5 – 1%). Einige öffentliche Äußerungen setzten dennoch zu Beginn der Pandemie Influenza und COVID-19 gleich und unterschätzten damit die Gefahrenlage für die Bevölkerung und das deutsche Gesundheitssystem. Tatsächlich hat die Gefahrenlage erst abgenommen, seitdem breite Teile der Bevölkerung durch eine Impfung oder Infektion eine Grundimmunität erworben haben und mehrheitlich vor schweren Infektionsverläufen geschützt sind (Meslé et al. 2024).
Durchseuchung als Strategie zur Bewältigung der Pandemie
In einigen Ländern wurden initial Studien zur Bestimmung einer möglicherweise bereits bestehenden Bevölkerungsimmunität gegen das neue Virus durchgeführt. Diese führten aber insgesamt nicht immer zu den erhofften Erkenntnissen. So wurde beispielsweise die Heinsberg-Studie in der Öffentlichkeit überinterpretiert, da diese, wie von den beteiligten Wissenschaftlern selbst bestätigt, keine für Deutschland repräsentative Antikörperprävalenz lieferte (Streeck et al. 2020). Auch die in dieser Studie ermittelte IFR (0,35%) dürfte nicht repräsentativ für Deutschland sein, da bei diesem auf einer Karnevalsveranstaltung beruhenden Ausbruchsgeschehen Vorerkrankte und Ältere vermutlich unterrepräsentiert waren. Davon abgesehen bot die ermittelte IFR keinen Anlass für entwarnende Interpretationen. Auch die geschätzte Immunitätsquote von regional etwa 15% bot keine Grundlage für die Annahme einer Bevölkerungsimmunität und der Forderung nach Beendigung von Kontrollmaßnahmen.
Öffentliche Ratschläge zur Herstellung einer Bevölkerungsimmunität durch Zulassen von Infektionen bei jüngeren Erwachsenen und Kindern müssen retrospektiv als klare Fehleinschätzung gewertet werden (Great Barrington Declaration 2020). Auch wenn zu Recht auf die großen Belastungen und Folgeschäden der eingeführten Kontaktreduktionsmaßnahmen hingewiesen wurde, unterlagen die Vorschläge zur sogenannten Durchseuchungsstrategie der falschen Vorstellung, dass nach einmaliger Infektion mit SARS-CoV-2 ein nachhaltiger Schutz vor erneuten Infektionen aufgebaut sei, der dann die Verbreitung des Virus auf die vulnerablen Gruppen verhindert. Da SARS-CoV-2 trotz mehrerer durchgemachten Infektionen und Impfungen noch heute zirkuliert, hätte die geforderte Aufhebung der Kontaktreduktionmaßnahmen zu einer andauernden Exposition der vulnerablen Personen aller Altersklassen geführt.
Alleiniger Schutz von Gruppen mit hohem Risiko für einen schweren Infektionsverlauf
Anhand der Verteilung von Infektionen und schweren Erkrankungen in der Bevölkerung ergab sich schon sehr früh der Eindruck, dass alte Menschen und solche mit Grunderkrankungen (Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, genetische Erkrankungen, Krebserkrankungen und Immunschwächen) durch COVID-19 in besonderem Maße gefährdet sind (Vygen-Bonnet et al. 2021a). Im Rahmen einer Durchseuchungsstrategie wären diese Gruppen von einer tödlichen Infektionsgefahr betroffen gewesen, gegen die sie sich nicht in eigenverantwortlicher Weise hätten schützen konnten. Daher schlugen Befürworter der Durchseuchungsstrategie einen gezielten Schutz dieser Gruppen vor. Zu den betroffenen Gruppen gehören aber nach Analyse der Ständigen Impfkommission (STIKO) in Deutschland ca. 36,5 Millionen Menschen. Es wurden keine umsetzbaren Handlungsvorschläge unterbreitet, wie man einen solch großen Teil der Bevölkerung spezifisch hätte schützen können. Diese Argumentationsstrategie beinhaltete daher die Gefährdung und Ausgrenzung schützenswerter gesellschaftlicher Gruppen und ignorierte die Tatsache, dass in der Zeit vor Beginn der Impfprogramme ein verlässlicher zielgerichteter Schutz von Risikogruppen ohne eine allgemeine Reduktion der Infektionstätigkeit in der Bevölkerung nicht möglich war.
Ebenso wurde ein selektiver Schutz hochbetagter Bevölkerungsgruppen als Variante der Durchseuchungsstrategie vorgeschlagen. Auch dieser Schutz war empirisch nicht umzusetzen, wie beispielsweise die Erfahrung in Schweden schon während der ersten Welle zeigte (Strittmatter 2020; Brusselaers et al. 2022). Dort ergab sich damals eine im Vergleich zu anderen skandinavischen Ländern etwa zehnfach höhere COVID-spezifische Mortalität, die stark durch Todesfälle bei Hochbetagten einschließlich Personen in Heimpflege bestimmt war (Juul et al. 2022). Das Konzept des selektiven Schutzes von Seniorenwohnheimen konnte auch anhand wissenschaftlich ausgewerteter Beobachtungsdaten nicht bestätigt werden (Bjoerkheim and Tabarrok 2022).
Zur Zeit der allgemeinen Kontaktreduktionsmaßnahmen war zudem noch keine flächendeckende Testung möglich, die im späteren Verlauf der Pandemie zunehmend Bestandteil von Schutzstrategien wurde. Zusätzlich zu den damals bekannten Risikogruppen gab es außerdem eine weitere, ursprünglich noch unbekannte Risikogruppe, deren Risikoprofil sich deutlich unterschiedlich darstellt. Das Auftreten von Long COVID in etwa 6% der von 2020 bis 2023 symptomatisch infizierten Erwachsenen und zusätzlich 1% der in diesem Zeitraum symptomatisch infizierten Kinder hätte im Falle einer Durchseuchungsstrategie zu einer großen gesellschaftsweiten Krankheitslast durch langwierige und schwer zu behandelnde Folgeerkrankungen geführt (Al-Aly et al. 2024; Cai et al. 2024).
Entscheidungsgrundlagen zu Schulschließungen
Die gesellschaftliche Diskussion um die Verhältnismäßigkeit von flächendeckenden Schulschließungen wird bestimmt von Vereinfachungen und retrospektiver Auslassung medizinisch und politisch bedeutender Entscheidungsgrundlagen. Vertreter der Fächer Virologie und Infektionsepidemiologie wiesen bereits früh in der Pandemie auf die Bedeutung der Expertise anderer Fächer zur Bewertung möglicher Nachteile durch Schulschließungen hin (GfV 2020). Eine Marginalisierung anderer Fachexpertisen zu Gunsten der Virologie lässt sich weder objektivieren, noch war sie jemals von Fachvertretern intendiert. Multiple gegenteilige Belege existieren in Form von Stellungnahmen (GfV 2020; Leopoldina 2020) und Besetzungslisten von Gremien der Politikberatung (Land NRW 2020).
In der Argumentation gegen Maßnahmen der Infektionskontrolle bei Kindern bestehen rückblickende Auslassungen. So stand zu Beginn der Pandemie der Schutz von Kindern vor damals unbekannten direkten und indirekten Folgen der Infektion im Vordergrund. Hierzu zählte ein damals neu erkanntes, aber schwer zu bezifferndem Risiko gravierender Nacherkrankungen bei Kindern (Verdoni et al. 2020). Im Bereich des Infektionsschutzes wurden in der öffentlichen Diskussion zwei grundsätzlich unterschiedliche Argumentationsfelder vermischt. Einerseits waren Kinder schon zu Beginn der Pandemie sichtlich geringer von schweren Infektionsverläufen betroffen, andererseits ließ dies aber keinerlei Rückschlüsse auf die Häufigkeit der Infektion bei Kindern und deren Rolle bei der Übertragung des Virus zu (Robert Koch-Institut 2020b). Im Vordergrund der Überlegungen stand zur damaligen Zeit die mögliche Einschleppung von Infektionen in Haushalte aus dem Schulbetrieb. Frühe Studien, die auch in Deutschland mit dem Ziel einer direkten Bestimmung der Infektionshäufigkeit und ‑übertragung in Schulen durchgeführt wurden, lieferten nur eingeschränkte Informationen, da sie zu Zeiten niedriger Inzidenz im Herbst 2020 stattfanden. Viele Schulstudien versäumten zudem eine Erfassung der Infektionshäufigkeit in der umgebenden Bevölkerung mit derselben Methodik wie in der Schule. Hierdurch verloren die Studien stark an Aussagekraft.
Einer unzureichenden Datenlage in Deutschland standen Erkenntnisse insbesondere aus dem Vereinigten Königreich gegenüber, wo eine fortlaufende Statistik zu bevölkerungsrepräsentativer Infektionsverbreitung (infection survey) des britischen Office for National Statistics und die fortlaufende REACT-1 Studie des Imperial College übereinstimmend zeigten, dass die Infektionshäufigkeit bei Kindern derjenigen bei Erwachsenen entsprach (Elliott et al. 2023; Office for National Statistics et al. 2020). Die Schulen konnten somit nicht als ein infektionsarmer Raum angesehen werden. Allein auf dieser Basis musste die Politik Entscheidungskompromisse finden und darin Regeln zur Infektionskontrolle in verschiedenen gesellschaftlichen Interaktionsbereichen festlegen (Arbeitsstätten, Schulen, Handel und Gastronomie, Vereine, Religionsgemeinschaften, etc.).
In der wissenschaftlichen Nachauswertung ist ein erheblicher Beitrag von Schulschließungen zur Verringerung der gesamtgesellschaftlichen Infektions-, Krankheits- und Todeszahlen belegt (Murphy et al. 2023). Unabhängig von diesen Daten und insbesondere in Anbetracht der vielfältigen negativen Folgen von Schulschließungen stellt sich jedoch die Frage, ob man einen Teil der Schulschließungen durch stärkere Eingriffe in anderen Lebensbereichen hätte ersetzen sollen. Hierzu hat die Gesellschaft für Virologie im August 2020 eine Stellungnahme verfasst, in der Maßnahmen vorgeschlagen wurden, um erneute Schulschließungen verhindern zu können (GfV 2020). In Gegensatz zu Schulen wurden Arbeitsplätze als Infektionsquellen in Deutschland, anders als in anderen Ländern, nur nachranging diskutiert. Auf diese Diskrepanz haben Mitglieder der GfV wiederholt öffentlich hingewiesen.
Bewertung des Nutzens und der Risiken von SARS-CoV-2 Impfstoffen
Die rasche Entwicklung der SARS-CoV-2 Impfstoffe und deren hohe Wirksamkeit gegen COVID-19 Erkrankungen haben ganz entscheidend zur Überwindung der Pandemie beigetragen. Es bleibt dabei häufig unberücksichtigt, dass dies nur auf Grund jahrzehntelanger Grundlagenforschung beispielsweise zur Stabilisierung von viralen Oberflächenproteinen (Sanders and Moore 2021) oder zu viralen Vektorimpfstoffen möglich war. Die Impfung mit dem BioNTech mRNA-Impfstoff (Comirnaty) verhinderte in den ersten Monaten nach der Impfung 19 von 20 COVID-19 Erkrankungen (Vygen-Bonnet 2021a). Nach Schätzungen der WHO wurden zwischen 2020 und März 2023 allein in Europa 1,6 Millionen Todesfälle durch die Impfung gegen COVID-19 verhindert (Meslé et al. 2024). Aus den Zulassungsstudien mit Comirnaty ergaben sich keine Hinweise auf eine Häufung von schweren unerwünschten medizinischen Ereignissen. Dabei wären Nebenwirkungen, die mit einer Häufigkeit von mehr als 0,1% in den ersten Wochen nach der Impfung auftreten, in der Zulassungsstudie mit großer Wahrscheinlichkeit (>95%) erfasst worden (Vygen-Bonnet et al. 2021a). Bei einer krankheitsbezogenen Sterblichkeit von 1% ist offensichtlich, dass die Risiko-Nutzen-Abschätzung daher eindeutig für die Impfung spricht.
Nach der Zulassung von Impfstoffen wird deren Sicherheit kontinuierlich überwacht. Das Paul-Ehrlich‑Institut führt eine umfassende Dokumentation der Verdachtsmeldungen auf schwere Impfnebenwirkungen durch und untersucht alle Fälle in Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten im Detail. Hinsichtlich der Überprüfung von Impf-Nebenwirkungen (Pharmakovigilanz) müssen zwei Phasen unterschieden werden, die in der Öffentlichkeit oft nicht getrennt voneinander dargestellt werden. Auf Grund der Meldung von Verdachtsfällen (sogenannte Spontanmeldungen) werden zunächst mögliche Risikosignale aufgenommen. Dies geschieht in vielen Ländern parallel. Kommt es zu einem solchen Signal, werden anhand von gezielten Fachinformationen Impfärzte in allen Ländern sensibilisiert, bestehende Daten aus Beobachtungsstudien unter neuen Aspekten ausgewertet und Patientengruppen gezielt nachuntersucht. Es erfolgt also eine gezielte Überprüfung eines anfänglichen Risikosignals. Die Auffassung, dass etwa durch verminderte Meldung von Verdachtsfällen in einem bestimmten Land, etwa in Deutschland, eine bestimmte Impf-Nebenwirkung übersehen werden könnte, ist somit grundlegend falsch. Die Entdeckung einer seltenen schweren Nebenwirkung des AstraZeneca-Impfstoffes (Vaxzevria), die Hirnvenenthrombose, belegt das Funktionieren dieser Überwachungssysteme, obwohl die Häufigkeit dieser Nebenwirkung nur in der Größenordnung von 1 bis 3 Fällen pro 100.000 geimpften Personen im Alter von 20 bis 59 Jahren lag (Vygen-Bonnet et al. 2021c; siehe auch Pottegard et al. 2021). Diese Beobachtung hatte in Deutschland die sofortige Aussetzung der Vaxzevria Impfungen in der betroffenen Altersgruppe zur Folge. Die gelegentlich geäußerten Befürchtungen, dass mRNA-Impfstoffe zu schädlichen genetischen Veränderungen führen oder das verbliebene DNA-Fragmente aus dem Herstellungsprozess der mRNA-Impfstoffe zu Tumorerkrankungen führen, sind rein spekulativ und aktuell durch keinerlei experimentelle Daten oder Studien belegt. Seit über 20 Jahren wird im Rahmen von klinischen Studien zur Entwicklung von DNA-basierten Impfstoffen und Gentherapeutika Plasmid DNA in Milligramm Mengen auf unterschiedlichen Wegen verabreicht (Wang and Yuan, 2024). Tierexperimentelle Untersuchungen zum Risiko einer chromosomalen Integration der Plasmid DNA zeigen, dass dieses Risiko kleiner ist als das Risiko spontaner chromosomaler Mutationen (Ledwith et al. 2000). Auch aus klinischen Studien liegen bisher keine Berichte über das Auftreten von Tumorerkrankungen nach DNA-Immunisierungen vor. Auf der Basis einer klinischen Phase 3 Studie (Khobragade et al. 2022) wurde in Indien 2021 sogar der DNA-Impfstoff ZyCov-D gegen SARS-CoV-2 für eine begrenzte Anwendung zugelassen. Der zwischenzeitlich geäußerte Verdacht erhöhter DNA-Rückstände in Chargen der mRNA Impfstoffe ist größtenteils auf Messfehler in der DNA-Bestimmung zurückzuführen, die nicht sicher zwischen DNA-Rückständen und hohen RNA-Konzentrationen der mRNA-Impfstoffe unterscheiden kann (Kaiser et al. 2024). Mittels hoch-sensitiver quantitativer PCR-Verfahren lagen die DNA-Rückstände bei 0,2 bis 2,2 ng pro Impfdosis Comirnaty (Speicher et al., 2023). Die Rückstände der DNA aus dem Herstellungsprozess der mRNA-Impfstoffe liegen damit ungefähr 1.000 bis 10.000-fach niedriger, als die bei DNA-Impfungen verwendeten und als sicher angesehenen Mengen.
Wirksamkeit von COVID-19 Impfstoffen gegen Infektionen und Erkrankungen
Hinsichtlich der Wirksamkeit der gängigen COVID-19 Impfstoffe haben sich in Deutschland vielfältige Missverständnisse eingestellt. Führend in der rückblickenden Diskussion ist die Darstellung, dass die Impfung entgegen anfänglicher Auffassung nicht vor Infektionsübertragung schütze. In der Tat wird bei der Bewertung der Wirksamkeit von Impfstoffen unterschieden zwischen einem Schutz vor Infektion des Geimpften, Erkrankung des Geimpften und Weiterverbreitung des Virus durch den Geimpften. Die mRNA Impfstoffe von BioNTech und Moderna wurden für einen Schutz vor schwerer COVID-19 Erkrankung entwickelt (daher heißen sie COVID-19 Impfstoffe), die ersten Anwendungsdaten zeigten aber auch einen sehr hohen Schutz vor Infektion im Bereich von 94,1 bis 95% (Vygen-Bonnet et al. 2021b). Mit dem Erscheinen der Delta-Variante reduzierte sich der Schutz vor Übertragung, war aber noch klar nachweisbar (Chemaitelly et al. 2021). Erst mit Erscheinen der Omikron-Variante ab dem Frühjahr 2022 ging der Übertragungsschutz zu großen Teilen verloren, während der effiziente Schutz vor schweren Erkrankungen weiter erhalten blieb (Altarawneh et al. 2022). Zu dieser Zeit war aber die Diskussion um eine Impfpflicht oder 3G/2G-Regelungen bereits Vergangenheit. Die entsprechende politische Diskussion wurde im Herbst 2021 geführt, als noch die Delta-Variante zirkulierte und ein nachweisbarer Übertragungsschutz durch die Impfung bestand. Politisch-mediale Verkürzungen können dabei problematisch für eine sachorientierte Diskussion sein. Der heute oft zitierte und verkürzte Ausspruch des damaligen Gesundheitsministers Jens Spahn von der „Pandemie der Ungeimpften“ war aus genannten Gründen nicht ohne wissenschaftliches Fundament. Tatsächlich führte das Robert Koch-Institut im Herbst 2021 anhand realer Daten aus Deutschland neun von zehn Übertragungen von COVID-19 auf die Beteiligung von mindestens einer ungeimpften Person zurück (Maier et al. 2022). Außerdem gab es zu dieser Zeit einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Impfquoten und der Zahl von schweren COVID-19 Infektionen im Vergleich der Bundesländer. Geringere Impfquoten führten hier lokal zu einer erheblichen Überlastung von Krankenhäusern, was auch der hohen Pathogenität der Delta-Variante zuzuschreiben war. Weder das Robert Koch-Institut noch die an der Wissenschaftskommunikation beteiligten GfV-Mitglieder führten das Infektionsgeschehen damals allein auf Ungeimpfte zurück. Die hohe Dringlichkeit einer möglichst vollständigen Impfannahme in der Bevölkerung wurde aber auf der Basis eines soliden wissenschaftlichen Fundaments kommuniziert.
In Bezug auf Langzeitfolgen einer COVID-19 Erkrankung, wurde in der Öffentlichkeit wiederholt die Existenz von Long COVID bezweifelt. Diese Äußerungen sind wissenschaftlich eindeutig widerlegt. Nach Evaluation durch die führenden Forschungsgruppen waren 2020 bis Ende 2023 ca. 6% aller Personen mit symptomatischer COVID-19 Erkrankung noch drei Monate nach der Infektion von einem der drei Haupt-Symptomkomplexe von Long COVID betroffen (Müdigkeit und Schmerz; kognitive Beeinträchtigung; bleibende COVID-Symptome insbesondere der Atemwege) (Al-Aly et al. 2024). Long COVID kommt zusätzlich auch nach asymptomatischen bzw. subklinischen COVID-Verläufen vor. In den evaluierten Ländern (hauptsächlich westliche Industrieländer) hatten 6% aller Erwachsenen und 1% aller Kinder mindestens einmal im Zeitraum 2020 bis Ende 2023 Long COVID. Das Auftreten von Long COVID wird dabei nicht durch die gleichen Risikoparameter (Alter und bestimmte Vorerkrankungen) wie schwere COVID-19 Verläufe begünstigt, so dass die Risikogruppe eine völlig andere ist. Eine vollständige Impfung reduziert das Risiko von Long COVID im Mittel um ca. 40% (Al-Aly et al. 2024). Daher hätte eine Durchseuchungsstrategie der Nicht-COVID-19-Risikogruppen vor dem Start der Impfkampagne unweigerlich zu einer noch höheren Anzahl von Long COVID Fällen geführt.
Nachträgliche wissenschaftliche Beurteilung der Wirksamkeit von nicht-pharmazeutischen Maßnahmen der Infektionskontrolle
Die nachträgliche Bewertung der Effektivität der nicht-pharmazeutischen Interventionen (NPIs) fällt in die Autorität infektionswissenschaftlicher Fächer, zu denen auch die Virologie gehört. Zu den Belastungen und Kosten der Maßnahmen äußern sich andere Fächer mit eigener Expertise, auf deren Bewertungen wir verweisen möchten. In der öffentlichen Debatte über die Wirksamkeit der Maßnahmen wurden in der Vergangenheit grob vereinfachende Aussagen getroffen, die teilweise auf einzelnen, unzureichend angelegten Studien basierten. Die Herausforderung bei einer formalen Bewertung von Maßnahmenwirksamkeit ist deren isolierte Betrachtung ohne den Beitrag anderer Effekte, sowie deren Bewertung in korrektem zeitlichem und ursächlichem Zusammenhang mit der Inzidenzentwicklung.
Die Gesellschaft für Virologie orientiert sich daher bezüglich der Wirksamkeit von NPIs an öffentlich verfügbaren Evidenzsynthesen, die eine Qualitätsbewertung und Gewichtung von Studien ebenso beinhalten wie eine Auswertung hochwertiger Studien in Synopsis. Die im Herbst 2023 veröffentlichten Evidenzsynthesen der britischen Royal Society haben den internationalen Literaturstand bis Ende 2021 berücksichtigt und fokussieren sich daher auf die Zeit bis zur Beendung wesentlicher nicht-pharmazeutischer Maßnahmen in vielen Industrieländern einschließlich Deutschland. Nach diesem Zeitpunkt wurde die Situation zunehmend schwerer vergleichbar, da unterschiedliche Länder angesichts unterschiedlich erfolgreicher Vakzinierungsquoten auf die damals aufkommende Omikron-Variante in sehr unterschiedlicher Weise reagierten. Die Evidenzsynthese der Royal Society erscheint uns daher für den Zweck der Maßnahmenbewertung am besten geeignet. Das verwendete Kriterium war in den meisten Sparten der Auswertung der Effekt einer gegebenen Maßnahme auf Parameter der Krankheitshäufigkeit (Inzidenz, Reproduktionsziffer, Krankenhausaufnahmen oder Todesfälle). Die komplexen Befunde dieser Studie können hier nur fokussiert und kursorisch dargestellt werden.
Die effektivsten NPIs waren Ausgangs- und Versammlungsbeschränkungen, deren Effekte bei geringer Gruppengröße stärker wurden (Murphy et al. 2023). Besuchseinschränkungen und insbesondere eine dauerhafte Kohortierung von Pflegenden mit Bewohnern von Pflegeheimen schützten die Zielgruppen, wenn gleichzeitig allgemeine Maßnahmen der Infektionskontrolle in Kraft waren (Murphy et al. 2023), jedoch befinden sich nur jeweils kleine Anteile der Bevölkerung von Personen mit besonderer Gefährdung (hochbetagte Personen, Personen mit spezifisch risikobelasteten Behinderungen wie Trisomien) in Heimpflege.
Schulschließungen hatten eine klare Wirkung auf die Übertragung, Krankenhaus-Aufnahmen und Todesfälle in den umgebenden Gemeinden (Murphy et al. 2023). Auch Kontaktmaßnahmen im laufenden Schulbetrieb (Masken, Distanzierung, Schichtsysteme) senkten die Übertragung in Schulen und der umgebenden Bevölkerung. Die Wiedereröffnung des Schulbetriebs nach Schließungen führte in den meisten Studien zu einem Anstieg der Inzidenz (Murphy et al. 2023).
Reduktionen der arbeitsbezogenen Mobilität (Arbeitsstätten-Schließungen, Kleingruppen, Homeoffice) hatten einen klaren und deutlichen Effekt, der ähnlich stark ausgeprägt war wie bei Schulschließungen (Murphy et al. 2023).
Schließungen von Bars und Restaurants hatten einen Effekt auf die Übertragung, Krankenhaus-Aufnahmen und Todesfälle in den umgebenden Gemeinden, auch Teilschließungen (kürzere Öffnungszeiten, weniger Plätze, kein Alkoholausschank) hatten nachweisbare Effekte (Murphy et al. 2023).
Die Mehrzahl der Untersuchungen zu Testungen und Fallverfolgung bzw. testabhängigen Isolationsmaßnahmen fanden eine gut nachweisbare Wirkung auf die Krankheitshäufigkeit (Littlecott et al. 2023). Hervorgehoben wurde eine randomisiert kontrollierte Studie, die zeigte, dass eine tägliche Testung von Kontaktpersonen nicht weniger effektiv in der Infektionskontrolle war als eine zehntägige Quarantäne. Für die Aufrechterhaltung des Schulbetrieb ergäben sich hieraus wichtige Perspektiven. Rückblickend war in Deutschland eine flächendeckende Testung aber erst ab 2021 möglich.
Nach Evidenzsynthese hatten Masken insgesamt einen deutlichen Effekt auf Übertragungen, wobei Masken besserer Qualität und verpflichtendes Tragen effektiver war als einfache Masken und freiwilliges Tragen (Boulos et al. 2023).
Insbesondere für allgemeine umgebungsbezogene Hygienemaßnahmen, die in Deutschland unter dem Begriff „Hygienekonzepte“ weite Verwendung fanden, fand die Evidenzsynthese nur schwache Belege einer Wirksamkeit, jedoch weisen die Autoren darauf hin, dass die entsprechenden Nachweise anhand des Studiendesigns oft schwer zu führen sind (Madhusudanan et al. 2023). Auch Grenzschließungen waren nach Analyse der vorliegenden Studien wenig effektiv für die Verringerung der Eintragung des Virus (Grépin et al. 2023).
Diese Stellungnahme greift nur eine Auswahl der wichtigsten Themen in der Pandemie auf. Die Gesellschaft für Virologie ruft ausdrücklich zu einer weitergehenden, kritischen und wissenschaftlichen Aufarbeitung aller relevanten Themen der Pandemie unter Einbeziehung weiterer Wissenschaftsdisziplinen auf.
Der Vorstand und Beirat der Gesellschaft für Virologie
6 gewählte Vorstands- und 10 gewählte Beiratsmitglieder der virologischen Fachgesellschaft von Deutschland, Österreich und der Schweiz mit über 1300 Mitgliedern
PDF-Version der Stellungnahme
Referenzen
Al-Aly Z, Davis H, McCorkell L, Soares L, Wulf-Hanson S, Iwasaki A, Topol EJ. Long COVID science, research and policy. Nat Med. 2024 Aug;30(8):2148-2164.
Altarawneh HN, Chemaitelly H, Ayoub HH, Tang P, Hasan MR, Yassine HM, Al-Khatib HA, Smatti MK, Coyle P, Al-Kanaani Z, Al-Kuwari E, Jeremijenko A, Kaleeckal AH, Latif AN, Shaik RM, et al. Effects of Previous Infection and Vaccination on Symptomatic Omicron Infections. N Engl J Med. 2022 Jul 7;387(1):21-34.
Bjoerkheim MB, Tabarrok A. Covid in the nursing homes: the US experience. Oxf Rev Econ Polic. 2022;38(4):887–911.
Boulos L, Curran JA, Gallant A, Wong H, Johnson C, Delahunty-Pike A, Saxinger L, Chu D, Comeau J, Flynn T, Clegg J, Dye C. Effectiveness of face masks for reducing transmission of SARS-CoV-2: a rapid systematic review. Philos Trans A Math Phys Eng Sci. 2023 Oct 9;381(2257):20230133.
Brusselaers N, Steadson D, Bjorklund K, Breland S, Stilhoff Sörensen J, Ewing A, Bergmann S, Steineck G. Correction: Evaluation of science advice during the COVID-19 pandemic in Sweden. Humanit Soc Sci Commun. 2022;9(1):239.
Cai M, Xie Y, Topol EJ, Al-Aly Z. Three-year outcomes of post-acute sequelae of COVID-19. Nat Med. 2024 Jun;30(6):1564-1573.
Chemaitelly H, Tang P, Hasan MR, AlMukdad S, Yassine HM, Benslimane FM, Al Khatib HA, Coyle P, Ayoub HH, Al Kanaani Z, Al Kuwari E, Jeremijenko A, Kaleeckal AH, Latif AN, Shaik RM, et al. Waning of BNT162b2 Vaccine Protection against SARS-CoV-2 Infection in Qatar. N Engl J Med. 2021 Dec 9;385(24):e83.
Dorigatti I, Okell L, Cori A et al. Severity of 2019-novel coronavirus (nCoV). Imperial College London. 2020.
Eales O, Haw D, Wang H, Atchison C, Ashby D, Cooke GS, Barclay W, Ward H, Darzi A, Donnelly CA, Chadeau-Hyam M, Elliott P, Riley S. Dynamics of SARS-CoV-2 infection hospitalisation and infection fatality ratios over 23 months in England. PLoS Biol. 2023 May 25;21(5):e3002118.
Elliott P, Whitaker M, Tang D, Eales O, Steyn N, Bodinier B, Wang H, Elliott J, Atchison C, Ashby D, Barclay W, Taylor G, Darzi A, Cooke GS, Ward H, et al. Design and Implementation of a National SARS-CoV-2 Monitoring Program in England: REACT-1 Study. Am J Public Health. 2023 May;113(5):545-554.
Gesellschaft für Virologie. Stellungnahme der Ad-hoc-Kommission SARS-CoV-2 der Gesellschaft für Virologie: SARS-CoV-2-Präventionsmassnahmen bei Schulbeginn nach den Sommerferien, 06.08.2020. Available from: https://g-f-v.org/massnahmen-bei-schulbeginn (accessed 10 March 2025).
Great Barrington Declaration 2020. Available from: https://gbdeclaration.org (accessed 10 March 2025).
Grépin KA, Aston J, Burns J. Effectiveness of international border control measures during the COVID-19 pandemic: a narrative synthesis of published systematic reviews. Philos Trans A Math Phys Eng Sci. 2023 Oct 9;381(2257):20230134.
Ioannidis JPA. Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data. Bull World Health Organ. 2021 Jan 1;99(1):19-33F.
Juul FE, Jodal HC, Barua I, Refsum E, Olsvik Ø, Helsingen LM, Løberg M, Bretthauer M, Kalager M, Emilsson L. Mortality in Norway and Sweden during the COVID-19 pandemic. Scand J Public Health. 2022 Feb;50(1):38-45.
Kaiser S, Kaiser S, Reis J, Marschalek R. Quantification of objective concentrations of DNA impurities in mRNA vaccines. Vaccine. 2025 Mar 21;55:127022.
Khobragade A, Bhate S, Ramaiah V, Deshpande S, Giri K, Phophle H, Supe P, Godara I, Revanna R, Nagarkar R, Sanmukhani J, Dey A, Rajanathan TMC, Kansagra K, Koradia P, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of the DNA SARS-CoV-2 vaccine (ZyCoV-D): the interim efficacy results of a phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled study in India. Lancet. 2022 Apr 2;399(10332):1313-1321.
Kraehling V, Kern M, Halwe S, Mueller H, Rohde C, Savini M, et al. Epidemiological study to detect active SARS-CoV-2 infections and seropositive persons in a selected cohort of employees in the Frankfurt am Main metropolitan area [preprint]. Cold Spring Harbor: medRxiv; 2020.
Land NRW. Expertenrat Corona 2020. Accessed 10 March 2025. Available from: https://www.land.nrw/expertenrat-corona (accessed 10 March 2025).
Ledwith BJ, Manam S, Troilo PJ, Barnum AB, Pauley CJ, Griffiths TG 2nd, Harper LB, Beare CM, Bagdon WJ, Nichols WW. Plasmid DNA vaccines: investigation of integration into host cellular DNA following intramuscular injection in mice. Intervirology. 2000;43(4-6):258-72.
Leopoldina. Dritte Ad-hoc-Stellungnahme: Coronavirus-Pandemie – Die Krise nachhaltig überwinden (2020). Available from: https://www.leopoldina.org/publikationen/detailansicht/publication/coronavirus-pandemie-die-krise-nachhaltig-ueberwinden-2020 (accessed 10 March 2025).
Levin AT, Hanage WP, Owusu-Boaitey N, Cochran KB, Walsh SP, Meyerowitz-Katz G. Assessing the age specificity of infection fatality rates for COVID-19: systematic review, meta-analysis, and public policy implications. Eur J Epidemiol. 2020 Dec;35(12):1123-1138.
Littlecott H, Herd C, O’Rourke J, Chaparro LT, Keeling M, James Rubin G, Fearon E. Effectiveness of testing, contact tracing and isolation interventions among the general population on reducing transmission of SARS-CoV-2: a systematic review. Philos Trans A Math Phys Eng Sci. 2023 Oct 9;381(2257):20230131.
Madhusudanan A, Iddon C, Cevik M, Naismith JH, Fitzgerald S. Non-pharmaceutical interventions for COVID-19: a systematic review on environmental control measures. Philos Trans A Math Phys Eng Sci. 2023 Oct 9;381(2257):20230130.
Maier BF, Wiedermann M, Burdinski A, Klamser PP, Jenny MA, Betsch C, Brockmann D. Germany’s fourth COVID-19 wave was mainly driven by the unvaccinated. Commun Med (Lond). 2022 Sep 16;2:116.
Meslé MMI, Brown J, Mook P, Katz MA, Hagan J, Pastore R, Benka B, Redlberger-Fritz M, Bossuyt N, Stouten V, Vernemmen C, Constantinou E, Maly M, Kynčl J, Sanca O, et al. Estimated number of lives directly saved by COVID-19 vaccination programmes in the WHO European Region from December, 2020, to March, 2023: a retrospective surveillance study. Lancet Respir Med. 2024 Sep;12(9):714-727.
Murphy C, Lim WW, Mills C, Wong JY, Chen D, Xie Y, Li M, Gould S, Xin H, Cheung JK, Bhatt S, Cowling BJ, Donnelly CA. Effectiveness of social distancing measures and lockdowns for reducing transmission of COVID-19 in non-healthcare, community-based settings. Philos Trans A Math Phys Eng Sci. 2023 Oct 9;381(2257):20230132.
O’Driscoll M, Ribeiro Dos Santos G, Wang L, Cummings DAT, Azman AS, Paireau J, Fontanet A, Cauchemez S, Salje H. Age-specific mortality and immunity patterns of SARS-CoV-2. Nature. 2021 Feb;590(7844):140-145.
Office for National Statistics, University of Oxford, University of Manchester, Public Health England and the Wellcome Trust. The Coronavirus Infection Survey study (2020). Available from: https://www.adruk.org/our-mission/our-impact/the-coronavirus-infection-survey-study (accessed 10 March 2025).
Pastor-Barriuso R, Pérez-Gómez B, Hernán MA, Pérez-Olmeda M, Yotti R, Oteo-Iglesias J, Sanmartín JL, León-Gómez I, Fernández-García A, Fernández-Navarro P, Cruz I, Martín M, Delgado-Sanz C, Fernández de Larrea N, León Paniagua J, et al. Infection fatality risk for SARS-CoV-2 in community dwelling population of Spain: nationwide seroepidemiological study. BMJ. 2020 Nov 27;371:m4509.
Pottegård A, Lund LC, Karlstad Ø, Dahl J, Andersen M, Hallas J, Lidegaard Ø, Tapia G, Gulseth HL, Ruiz PL, Watle SV, Mikkelsen AP, Pedersen L, Sørensen HT, Thomsen RW, Hviid A. Arterial events, venous thromboembolism, thrombocytopenia, and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: population based cohort study. BMJ. 2021 May 5;373:n1114.
Riedmann U, Chalupka A, Richter L, Sprenger M, Rauch W, Krause R, Willeit P, Schennach H, Benka B, Werber D, Høeg TB, Ioannidis JP, Pilz S. COVID-19 case fatality rate and infection fatality rate from 2020 to 2023: Nationwide analysis in Austria. J Infect Public Health. 2025 Apr;18(4):102698.
Robert Koch-Institut. Täglicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) 04.03.2020 –AKTUALISIERTER STAND FÜR DEUTSCHLAND. 2020a. Available from: https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/C/COVID-19-Pandemie/Situationsberichte/Maerz-Aug_2020/2020-03-04-de.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (accessed 10 March 2025).
Robert Koch-Institut. Epidemiologisches Bulletin 12/2020. 2020b. Available from: https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Epidemiologisches-Bulletin/2020/12_20.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (accessed 10 March 2025).
Sanders RW, Moore JP. Virus vaccines: proteins prefer prolines. Cell Host Microbe. 2021 Mar 10;29(3):327-333.
Speicher DJ, Rose J, Gutschi LM, Wiseman D, McKernan: DNA fragments detected in monovalent and bivalent Pfizer/BioNTech and Moderna modRNA COVID-19 vaccines from Ontario, Canada: Exploratory dose response relationship with serious adverse events. 2023; Available from: https://www.researchgate.net/publication/374870815 (accessed 10 March 2025).
Streeck H, Schulte B, Kümmerer BM, Richter E, Höller T, Fuhrmann C, Bartok E, Dolscheid-Pommerich R, Berger M, Wessendorf L, Eschbach-Bludau M, Kellings A, Schwaiger A, Coenen M, Hoffmann P, et al. Infection fatality rate of SARS-CoV2 in a super-spreading event in Germany. Nat Commun. 2020 Nov 17;11(1):5829.
Strittmatter K. Corona in Schweden: Der König attestiert Versagen. 17 December 2020. Available from: https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-schweden-koenig-1.5151678 (accessed 10 March 2025).
Verdoni L, Mazza A, Gervasoni A, Martelli L, Ruggeri M, Ciuffreda M, Bonanomi E, D’Antiga L. An outbreak of severe Kawasaki-like disease at the Italian epicentre of the SARS-CoV-2 epidemic: an observational cohort study. Lancet. 2020 Jun 6;395(10239):1771-1778.
Verity R, Okell LC, Dorigatti I, Winskill P, Whittaker C, Imai N, Cuomo-Dannenburg G, Thompson H, Walker PGT, Fu H, Dighe A, Griffin JT, Baguelin M, Bhatia S, Boonyasiri A, et al. Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based analysis. Lancet Infect Dis. 2020 Jun;20(6):669-677.
Vygen-Bonnet S, Koch J, Bogdan C, Harder T, Heininger U, Kling K, Littmann M, Meerpohl J, Meyer H, Mertens T, Schmid-Küpke N, Scholz S, Terhardt M, Treskova-Schwarzbach M, Überla K, van der Sande M, Wichmann O, Wicker S, Wiedermann U, Wild V, von Kries R: Beschluss und Wissenschaftliche Begründung der Ständigen Impfkommission (STIKO) für die COVID-19-Impfempfehlung Epid Bull 2021a;2:3 -63.
Vygen-Bonnet S, Koch J, Bogdan C, Harder T, Heininger U, Kling K, Littmann M, Meerpohl J, Meyer H, Mertens T, Schmid-Küpke N, Scholz S, Terhardt M, Treskova-Schwarzbach M, Überla K, van der Sande M, Wichmann O, Wicker S, Wiedermann U, Wild V, von Kries R: Beschluss der STIKO zur 1. Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung und die dazugehörige wissenschaftliche Begründung Epid Bull 2021b;2:64 -132.
Vygen-Bonnet S, Koch J, Bogdan C, Harder T, Heininger U, Kling K, Littmann M, Meerpohl J, Meyer H, Mertens T, Michaelis K, Schmid-Küpke N, Scholz S, Terhardt M, Treskova-Schwarzbach M, Überla K, van der Sande M, Waize M, Wichmann O, Wicker S, Wiedermann U, Wild V, von Kries R: Beschluss der STIKO zur 4. Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung und die dazugehörige wissenschaftliche Begründung Epid Bull 2021c; 16:3 -78
Wang C, Yuan F. A comprehensive comparison of DNA and RNA vaccines. Adv Drug Deliv Rev. 2024 Jul;210:115340.