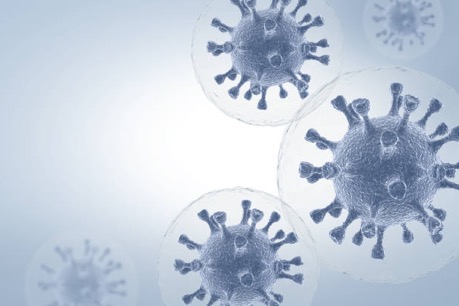Stellungnahme der Kommission „Zoonosen und Virusinfektionen der Tiere“ zu H5N1
11/11/2025
Stellungnahme der Kommission „Zoonosen und Virusinfektionen der Tiere“ zu H5N1
Die hochpathogene aviäre Influenza vom Subtyp H5N1 ist eine zoonotische und potenziell lebensbedrohliche Virusinfektion, verursacht durch Influenzaviren der Gattung Influenza A. H5N1 gehört zu den Subtypen der aviären Influenza, die vor allem Wildvögel (insbesondere Wasservögel) betreffen und von dort regelmäßig auf Hausgeflügel übertragen werden. Seit dem erstmaligen Auftreten 1959 in Schottland hat sich das Virus weltweit verbreitet und in Wildvogelpopulationen etabliert, die als dauerhaftes Reservoir dienen.
In den vergangenen Jahren kam es in Europa immer wieder zu Ausbrüchen von H5N1 bei Wildvögeln und Hausgeflügel. Besonders während der Zugvogelsaison werden wiederholt Viren in Geflügelhaltungen eingetragen. Auch im Jahr 2025 wurden H5N1-Infektionen bei Wildvögeln sowie in Geflügelbetrieben in mehreren europäischen Ländern, darunter Deutschland, Ungarn und Dänemark, bestätigt. In Deutschland hat sich die Lage zuletzt deutlich verschärft: Nach Nachweisen bei Wildvögeln in allen Bundesländern kam es zunehmend zu Einträgen in Geflügelhaltungen. Zur Eindämmung der Ausbreitung mussten bisher bereits mehrere hunderttausend Hühner, Puten, Enten und Gänse gekeult werden. Besonders betroffen sind Betriebe in Norddeutschland, wo großflächige Schutz- und Überwachungszonen eingerichtet wurden.
Während das H5N1-Virus klassischerweise bislang vor allem bei Vögeln zirkulierte, wurde im Jahr 2024 erstmals ein breites Infektionsgeschehen bei Milchkühen in den Vereinigten Staaten beschrieben. Dieser Ausbruch stellt eine neue epidemiologische Situation dar. Anfang 2024 wurden in mehreren US-Bundesstaaten Infektionen mit dem H5N1-Virus bei laktierenden Tieren in Milchviehbeständen nachgewiesen. Bis Ende des Jahres waren über 600 Betriebe betroffen. Klinisch zeigten die infizierten Tiere vor allem einen Rückgang der Milchproduktion sowie eine Veränderung der Milchbeschaffenheit. Der Erreger konnte in der Milchdrüse und in Rohmilchproben nachgewiesen werden. Die Pasteurisierung H5N1-kontaminierter Milch führt zur vollständigen Inaktivierung dieser Viren.
Molekulare Analysen ergaben, dass die H5N1-Viren aus den Rinderbeständen Mutationen aufweisen, die ihre Bindung an Säugetierrezeptoren und damit auch an menschliche Rezeptoren ermöglichen. Damit unterscheiden sie sich in ihrer Wirtsspezifität teilweise von klassischen H5N1-Stämmen, die bevorzugt an Rezeptoren von Vögeln binden. In den USA wurden zwei genetisch unterschiedliche Viruslinien identifiziert: der bislang dominante Stamm B3.13 sowie ein neu beschriebenes Isolat D1.1. Diese Befunde deuten auf mehrere unabhängige Übertragungen vom Wildvogel auf Rinder hin. Die innerbetriebliche Ausbreitung erfolgt hauptsächlich über kontaminiertes Melkgeschirr. Hinweise auf eine effiziente Tier-zu-Tier-Übertragung innerhalb der Milchviehbestände liegen bislang nicht vor. Verschiedene Studien zeigen jedoch, dass diese H5N1-Viren zwischen Säugetieren wiederholt übertragen werden können.
Im Zusammenhang mit den Rinder-Ausbrüchen wurden in den USA auch wenige humane Infektionen dokumentiert, überwiegend bei Beschäftigten in Milchviehbetrieben mit engem Tierkontakt. Die Krankheitsverläufe waren hier mild, meist mit lokalisierten Symptomen wie einer Bindehautentzündung. Eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung wurde bislang nicht beobachtet. Entsprechend bewerten die US-Gesundheitsbehörden sowie die WHO und WOAH das Risiko für die Allgemeinbevölkerung derzeit als gering.
Eine allgemeine Impfung gegen H5-Viren beim Menschen ist derzeit nicht angezeigt und wird von der STIKO nicht empfohlen. Allerdings wurde die Empfehlung für die jährliche saisonale Grippeimpfung auf Personen ausgeweitet, die regelmäßig und direkt mit Geflügel oder Wildvögeln in Kontakt kommen [1]. Diese Impfung schützt zwar nicht gegen aviäre Influenzaviren wie H5N1, kann aber das Risiko einer Doppelinfektion mit einem saisonalen und einem aviären Influenzavirus verringern und damit die Entstehung neuartiger, potenziell pandemischer Reassortanten erschweren. Für Personen, die einem besonderen Risiko hinsichtlich eines möglichen Kontakts mit großen Virusmengen ausgesetzt sind, wäre ein Impfangebot zum Schutz gegen H5-Viren durchaus wünschenswert, ist in Deutschland derzeit jedoch nicht verfügbar. Ein in der EU zugelassener H5-Impfstoff wurde in den vergangenen Jahren in Finnland bei besonders gefährdeten Personen bereits eingesetzt.
Die Entdeckung neuer H5N1-Isolate in Säugetieren insbesondere in Milchkühen markiert eine neue Situation in der Epidemiologie dieses Virus. Erstmals konnte gezeigt werden, dass H5N1-Viren effizient in bislang untypischen Wirtstieren zirkulieren können. Dies unterstreicht das erhebliche Anpassungspotenzial des Virus und verdeutlicht die Dringlichkeit einer regelmäßigen Überwachung sowie präventiver Maßnahmen bei empfänglichen Nutztieren, um weitere Anpassungen an Säugetiere zu verhindern.
Für Geflügelpopulationen stellt H5N1 weiterhin eine erhebliche Bedrohung dar. Ausbrüche führen regelmäßig zu hohen Tierverlusten und beträchtlichen wirtschaftlichen Schäden. Bisherige Maßnahmen wie Aufstallungsgebote, Hygieneregeln und die Keulung betroffener Bestände dienen vor allem der Minimierung der Exposition von Nutztieren. Diese Strategien waren bislang bei lokal begrenzten, kontrollierbaren Ausbrüchen ausreichend, geraten jedoch angesichts der zunehmend endemischen Situation und der fortlaufenden Einschleppungsgefahr durch Wildvögel an ihre Grenzen.
Ein sinnvoller nächster Schritt ist daher der gezielte Einsatz geeigneter Impfstoffe, um Tierverluste, wirtschaftliche Schäden und Virusausbreitung zu reduzieren. In der EU wurden im Jahr 2023 Impfungen gegen H5N1 unter strengen Überwachungsvorgaben zugelassen (EU-Delegierte Verordnung 2023/361). Zwei H5N1-Impfstoffe erhielten bereits eine EU-Zulassung. In Deutschland sind diese Impfstoffe bisher noch nicht zugelassen, entsprechende Anträge der Hersteller befinden sich jedoch in Vorbereitung. Mehrere Länder darunter Frankreich, Italien, die Niederlande und Deutschland haben begrenzte Impfprogramme zur Prüfung der Wirksamkeit bei verschiedenen Geflügelarten eingeführt oder befinden sich aktuell in Vorbereitung.
Die verfügbaren H5N1-Impfstoffe, basierend auf rekombinanten H5-Antigenen, Vektorimpfstoffen oder mRNA-Konstrukten, zeigen eine gute Schutzwirkung gegen klinische Erkrankungen und reduzieren die Virusausscheidung deutlich. Die bisher verfügbaren Impfstoffe müssen laut EU-Vorgaben Tot-Impfstoffe sein, d.h. von ihnen selbst geht kein Infektionsrisiko aus. Durch Impfungen in Risikogebieten kann das Risiko von Massentötungen erheblich gesenkt werden.
Impfstrategien müssen allerdings gemäß der EU-Richtlinie eng mit strengen Überwachungsmaßnahmen im Sinne einer virologischen Überwachung kombiniert werden, um die Entstehung von unentdeckten Virusinfektionen unter der Impfdecke im Blick zu behalten. Impfprogramme ersetzen nicht die Notwendigkeit von Biosicherheitsmaßnahmen und epidemiologischer Überwachung, sondern müssen eng mit diesen verzahnt sein.
Diese umfassende Überwachung stellt in der Praxis jedoch eine erhebliche organisatorische und wirtschaftliche Herausforderung dar, da sie hohe Anforderungen an Personal, Laborkapazitäten und finanzielle Ressourcen stellt. Antigen-Schnelltests stehen zwar zur Verfügung, sind jedoch weniger empfindlich. Daher müssen praxisgerechtere Untersuchungsstrategien entwickelt werden, etwa angepasste Untersuchungsfrequenzen in Mastgeflügelbeständen oder die ergänzende Nutzung von Umwelt-, Wasser- oder Sammelproben in Kombination mit serologischen Tests.
Die aktuelle Situation verdeutlicht eindrücklich die enge Verknüpfung zwischen Tier-, Umwelt- und Menschengesundheit, wie sie im One-Health-Konzept verankert ist. Nur durch koordinierte Überwachungs-, Forschungs- und Präventionsmaßnahmen lässt sich das Risiko für Nutztiere begrenzen und das zoonotische Potenzial neu auftretender aviärer Influenzaviren frühzeitig erkennen.
Zusammenfassend unterstützt die Kommission und der Vorstand der GfV
- die STIKO-Impf-Empfehlung für Menschen mit Kontakt zu Wildvögeln/ Geflügel
- die Forderungen nach Änderungen bzgl. der Immunisierungsmöglichkeiten gegen hochpathogene aviäre Influenzaviren bei Geflügel
- die Einführung von praktikablen Untersuchungsstrategien zur kontinuierlichen Überwachung von geimpften Tierbeständen sowie
- eine Kontinuität im Bereich der Forschung und Entwicklung zu Tierseuchen mit Zoonosepotential.
Klicken Sie hier, um zur PDF Version der Stellungnahme zu gelangen.
[1] Epidemiologisches Bulletin 29/2025, Seiten 11-22, abgerufen am 10.11.2025: https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Epidemiologisches-Bulletin/2025/29_25.pdf?__blob=publicationFile&v=6